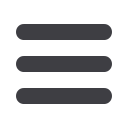

19
Der Russische Revolutionszyklus 1905–1932
Einsichten und Perspektiven 2 | 17
Universitäten zu ihnen kommenden jungen Menschen für
„Wirrköpfe“, deren politische Anliegen sie nicht verstan-
den und die sie deshalb als Fremde ausgrenzten. Oftmals
sahen die Bauern in den agrarsozialistischen Romantikern
sogar aufwieglerische Störenfriede und lieferten sie darum
bei der zarischen Polizei ab, die sodann die Unruhestif-
ter nach Sibirien verbannte. Vera Figner, die damals als
Ärztin und Hebamme auf das Dorf gezogen war, fühlte
sich bald „einsam, schwach und energielos in diesem
Bauernmeer“.
56
Auch ihr blieb die bittere Enttäuschung
nicht erspart, dass die umworbenen Bauern mit einer
politischen Revolution noch nichts am Hut hatten. Ein
anderer Aktivist schrieb daher voller Frustration: „Der
Sozialismus prallte von den Menschen ab wie Erbsen von
einer Wand.“
57
Die Intellektuellen und Revolutionäre, die
sich selbst dazu ermächtigt hatten, die Rolle des Anwalts
des einfachen Volkes zu spielen, um die Bauern aus Unbil-
dung und Unfreiheit herauszuführen, scheiterten an der
zur damaligen Zeit noch kaum überbrückbaren kulturel-
len Kluft, die sich durch die russische Gesellschaft zog.
58
Auf noch größere Probleme als die sozialistischen
Kräfte trafen die Liberalen bei ihrem Versuch, sich mit
ihrem Programm bei den Bauern Gehör zu verschaffen. In
den
Zemstva
arbeiteten die bäuerlichen Vertreter zwar mit
den Repräsentanten des liberalen Landadels zusammen.
Die Dorfbewohner wussten mitunter neue kulturelle In
stitutionen wie Gerichte, Schulen, Krankenhäuser, Agrar-
gesellschaften und Genossenschaften für sich zu nutzen,
die dank des verstärkten Engagements liberal gesinnter
Bildungsschichten entstanden waren und an Bedeutung
gewannen. Auch wenn sie vorsichtig aufeinander zugin-
gen, trennten die bürgerliche Elite und die Bauernschaft
weiterhin Welten. Oftmals konnten sich die Gebildeten
nicht ihres Überlegenheitsdünkels entledigen und traten
zu gern dem Landvolk gegenüber als Lehrmeister auf.
59
Die Dorfbewohner hingegen sahen in den sich um ihre
Traditionen und ihr Wohlergehen sorgenden Stadtmen-
56 Zit. n. Nolte (wie Anm. 34), S. 162. Zu Vera Figner vgl. ausführlich Stephan
Rindlisbacher: Leben für die Sache. Vera Figner, Vera Zasulič und das radi-
kale Milieu im späten Zarenreich, Wiesbaden 2014; Lynne Ann Hartnett:
The Defiant Life of Vera Figner. Surviving the Russian Revolution. Bloo-
mington 2014.
57 Zit. n. Berlin (wie Anm. 55), S. 307.
58 Beyrau/Hildermeier (wie Anm. 30), S. 155–166; Daniel Field: Peasants and
Propagandists in the Russian Movement to the People in 1874, London
1992; Cathy A. Frierson: Peasant Icons. Representations of Rural People in
Late 19th Century Russia, Oxford 1993, S. 38–47.
59 So Yanni Kotsonis: Making Peasant Backward. Agricultural Cooperatives
and the Agrarian Question in Russia, 1861–1914, Basingstoke 1999.
schen weiterhin Fremde, denen sie nur bedingt Vertrauen
entgegenbrachten. Während es den armen Bauern umBrot
und die Sicherung minimaler Lebensbedürfnisse ging, for-
derten die liberalen Akademiker, Fabrikanten und Adlige
politische Mitsprache und Machtteilhabe am Staatsge-
schehen. Der Unmut an der zarischen Autokratie und der
noch ausstehenden durchgreifenden Emanzipation der
Sozialbeziehungen speiste sich demnach aus unterschied-
lichen Quellen; die Ziele des einerseits sozialen, anderer-
seits politischen Aufbegehrens waren grundverschieden.
Verstanden die Bildungsschichten unter Freiheit vor allem
eine durch eine Verfassungsreform garantierte Meinungs-
vielfalt und politische Partizipationsrechte, drängten die
Bauern vor allem auf eine umfassende Landreform, um
dadurch die Befreiung von Unterdrückung und Not zu
erreichen. Diese jeweiligen Agenden ließen sich nicht so
ohne weiteres in Übereinstimmung bringen; die Ambi-
valenz der Interessen erwies sich kaum organisierbar. Das
erschwerte es erheblich, dass zwischen den Gebildeten
und den Bauern über die gemeinsame Gegnerschaft gegen
das Zarenregime hinaus eine belastbare Allianz entstand.
Fürst Georgij L’vov (1861–1925), einer der führenden
russischen Liberalen, bekannte in den 1890er Jahren ehr-
lich, die reformorientierten Eliten wüssten „soviel über
das Gebiet von Tula wie über Zentralafrika.“
60
60 Figes (wie Anm. 46), S. 63.
Fürst Georgij L’vov war Anführer der Liberalen im Reich und wurde 1917
Ministerpräsident. Im Bild die provisorische russische Regierung im März 1917.
L’vov ist Zweiter von links; Zweiter von rechts: Aleksandr F. Kerenskij.
Foto: ullstein bild/Archiv Gerstenberg


















