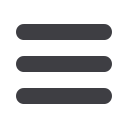
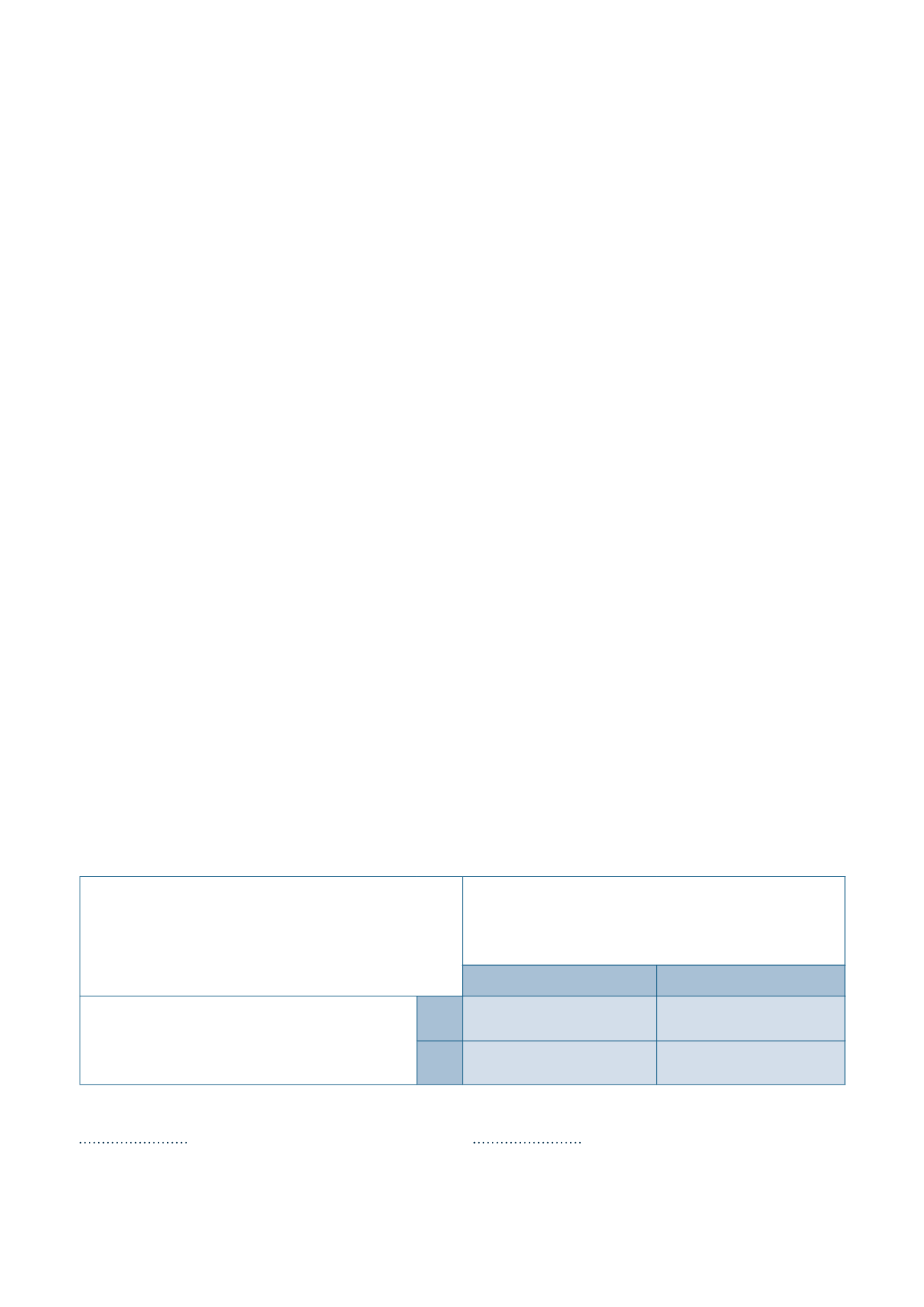
47
„Lebenswelten junger Muslime in Deutschland“ – reloaded
Einsichten und Perspektiven 4 | 16
Forschungsfragen, Theoretisches und methodische
Konsequenzen
Das Forschungsfeld ist weit. Ein erster Überblick zeigt
zunächst, dass es keine einheitliche Definition von (sozia
ler bzw. interkultureller) Integration gibt. Wir haben es
mit einer Vielfalt an Begriffen (z.B. Integration, Inklu-
sion, Assimilation, Akkulturation) und Konzepten zu tun,
die sich je nach wissenschaftlichem Hintergrund bzw.
theoretischer Ausrichtung unterscheiden. Ähnlich wie im
deutschen Sprachraum werden aber auch in der internati-
onalen Forschung vor allem zwei Grunddimensionen von
Integration hervorgehoben: a) sozialstrukturelle Integra-
tion, die sich u.a. auf die rechtliche Integration, politische
Integration, Bildungsintegration oder Arbeitsweltintegra-
tion bezieht, und b) sozialkulturelle Integration, die auf
die Eingliederung in die differenzierte Vielfalt der Kultur
verweist. Aus sozialpsychologischer Sicht ist vor allem die
zweite Dimension die eigentlich interessante. Einer der
einflussreichsten Ansätze, der sich in diesem Sinne der
Erklärung und Operationalisierung von Integration wid-
met, stammt von Bourhis et al. (1997).
5
Es handelt sich
um ein zweidimensionales Modell der Akkulturations
orientierung. Auch in der hier vorgestellten Studie wurde
dieser Ansatz zugrunde gelegt, weil er erstens einen psy-
chologischen Bezugsrahmen für die Akkulturations- und
Integrationsforschung bietet, sowie es zweitens ermöglicht,
sowohl die Akkulturationspräferenzen der Zuwanderer als
auch die Erwartungen der Einheimischen zu berücksich-
tigen, und drittens weil er empirisch sehr gut fundiert ist.
Als Akkulturation wird dabei jener Prozess bezeichnet,
5 Richard Y. Bourhis/Léna Céline Moïse/Stephane Perreault/Sacha Senécal:
Towards an interactive acculturation model: A social psychological ap-
proach, in: International Journal of Psychology 32(6), S. 369–386.
der in Folge von Migration durch direkten und andau-
ernden Kontakt der Zuwanderer und Einheimischen zu
Veränderungen in den Kulturen
beider
Gruppen führen
kann. Diese Veränderungen können alltägliche Dinge wie
Essgewohnheiten, aber auch psychologische Aspekte, wie
Einstellungen, Werte oder das Selbstbild einzelner Per-
sonen oder eben Sprache, Normen, Werte, Religion der
Zuwanderer und Einheimischen betreffen. Diesem Ansatz
entsprechend wird im Folgenden unter Integration ein
Beibehalten der traditionellen Herkunftskultur bei einem
gleichzeitigen Übernehmen der neuen Mehrheitskultur
verstanden. Erfasst wird Integration somit als Ergebnis
einer Identifikationsleistung, und zwar sowohl aus Sicht
der Migrantinnen und Migranten, als auch
aus der Per-
spektive der Mitglieder aus der Mehrheitskultur. Die
folgende Tabelle illustriert den Ansatz und gibt auch aus-
zugsweise jene Aussagen wieder, die den befragten Musli-
men und Nicht-Muslimen vorgelegt wurden.
Eine zweite Entscheidung bezog sich auf den Begriff
Radikalismus. Abgeleitet von
„radix“
(dem lateinischen
Wort für „Wurzel“) werden damit meist politische, religiöse
oder sonstige Strömungen bezeichnet, die „von der Wurzel
her“ Veränderungen im gesellschaftlichen oder politischen
Bereich fordern. Als radikal werden Personen oder Orga-
nisationen bezeichnet, die sich tiefgehende gesellschaftliche
und politische Veränderungen in Deutschland wünschen
und anstreben, das gegenwärtige politische und rechtliche
System der Bundesrepublik aber zumindest respektieren
und keine illegalen oder gewalttätigen Maßnahmen zur
Änderung dieses Systems ergreifen oder gutheißen.
6
6 Diese Definition wird auch von den Verfassungsschutzbehörden vertreten,
vgl. z.B.
http://www.verfassungsschutz.bayern.de/ueberuns/service/glossar/extremismus-radikalismus/index.html [Stand: 23.11.2016].
Tabelle 1: Vier-Dimensionen-Schema der Akkulturation in Anlehnung an Bourhis et al. (1997)
Aus Sicht der Migrant/innen:
„Wir sollten unsere
Herkunftskultur bewahren …“
Aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft:
„Die Migrant/innen
sollten ihre Herkunftskultur bewahren …“
Ja
Nein
Aus Sicht der Migrant/innen:
„Wir sollten die
Mehrheitskultur übernehmen …“
Aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft:
„Die Migrant/
innen sollten die Mehrheitskultur übernehmen …“
Ja
Integration
Assimilation
Nein
Separation
Marginalisierung
Quelle: Frindte/Boehnke/Kreikenbom/Wagner (wie Anm. 3), S. 27.


















