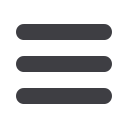
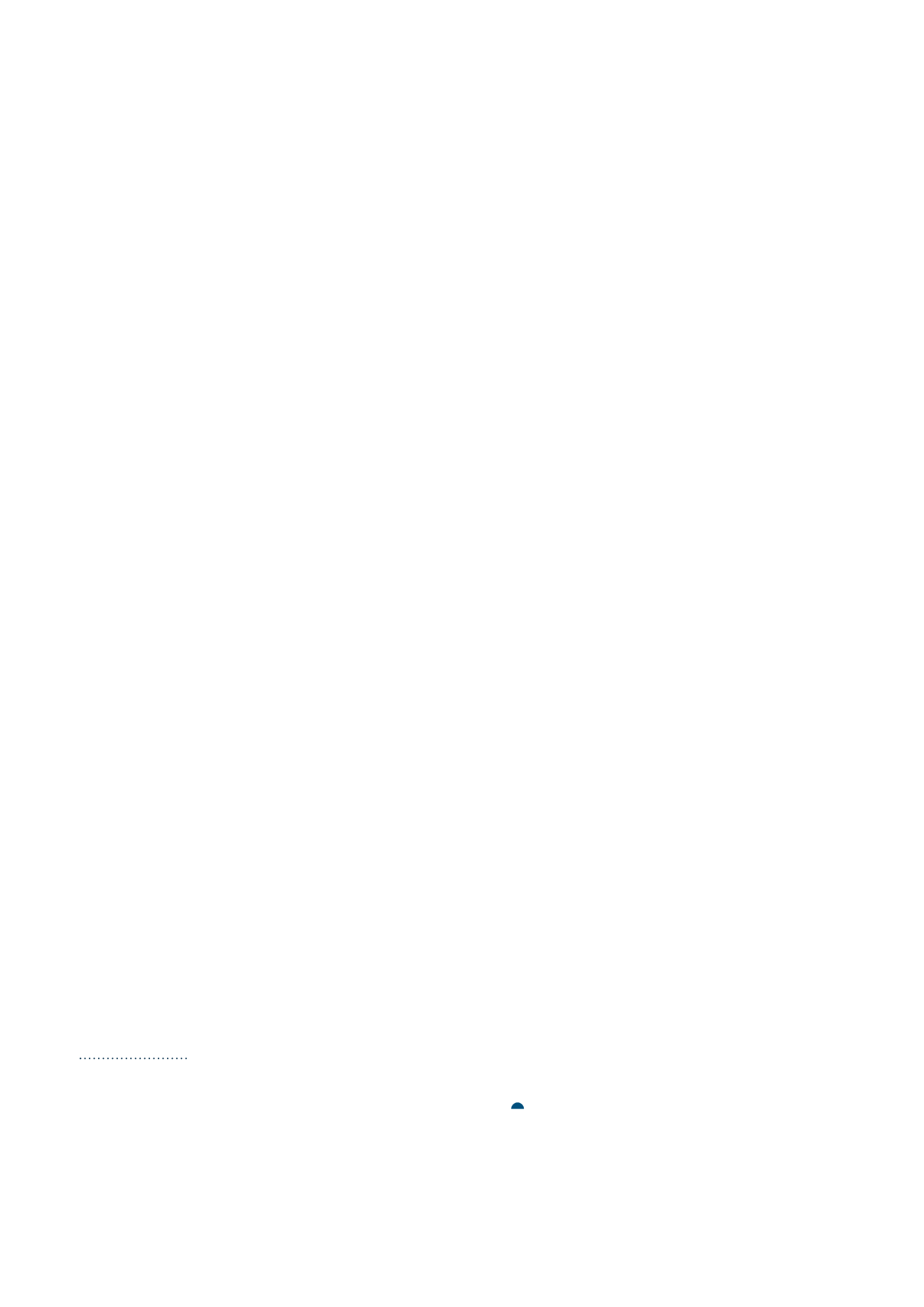
55
„Lebenswelten junger Muslime in Deutschland“ – reloaded
Einsichten und Perspektiven 4 | 16
Mittels multipler Mediatoranalysen
18
konnte diese Annahme
geprüft werden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3 sehr
stark vereinfacht und ohne Angaben der statistischen
Kennziffern dargestellt.
19
Die jeweils grau und gestrichelt
gezeichneten Pfeile zeigen die direkten Einflusspfade ohne
Berücksichtigung der jeweiligen Mediatoren. Die schwarz
gezeichneten Pfeile verweisen auf Pfade, wenn die Media-
toren berücksichtigt werden.
Wie lässt sich diese Abbildung lesen? Zunächst ein-
mal verdeutlichen die Ergebnisse, dass die Einflüsse der
Prädiktoren (also der Variablen auf der linken Seite der
Abbildung) in signifikanter Weise über die Identifikation
als Musliminnen und Muslime („Identifikation mit der
Gemeinschaft der Muslime“ als Mediator) vermittelt wer-
den. Der stärkste Einfluss geht von der Religiosität über
die Identifikation mit der Gemeinschaft der Muslime auf
islamistisch-fundamentalistische Überzeugungen aus. Die
Befunde zeigen auch, dass die direkten Effekte der Prädik-
toren „gruppenbezogene Diskriminierung“, „Respekt vor
familiären Sitten“, „Religiosität“ und „autoritäre Überzeu-
gungen“ auf „islamistisch-fundamentalistische Überzeu-
gungen“ nach Einführung des Mediators („Identifikation
mit der Gemeinschaft der Muslime“) zwar größtenteils
signifikant bleiben, sich jedoch deutlich verringern (des-
halb grau und gestrichelt gezeichnet).
Außerdem verweisen die Ergebnisse darauf, dass die
islamistisch-fundamentalistischen Überzeugungen nega-
tive Emotionen gegenüber „dem Westen“ und Vorurteile
gegenüber den „Deutschen“ und „demWesten“ beeinflus-
sen. Über diesen Weg (schwarze Pfeile) können derartige
Überzeugungen auch die Akzeptanz von ideologisch
begründeter Gruppengewalt befördern.
Für fundamentalistische und radikalisierte Musliminnen
und Muslime zählt vor allem die (konstruierte) Identität
als „wahre“ Musliminnen und Muslime. Gerade im sehr
strengen Werte- und Normensystem des fundamentalisti-
schen Islams liegt demnach seine Attraktivität. Durch das
ausschließliche Bekenntnis hierzu wird scheinbar eine Last
von den jeweiligen Individuen genommen: Man weiß wie-
der sicher, wer man ist und was von einem erwartet wird.
Zugleich wird man Teil eines Kollektivs, in dem strenge
18 Mediatoren sind vermittelnde Bedingungen zwischen den möglichen Ur-
sachen und den vermuteten Wirkungen. Prädiktoren sind vorhersagende
Bedingungen oder mögliche Ursachen – in empirischen Untersuchungen
auch unabhängige Variablen genannt – mit denen Wirkungen (abhängige
Variablen) erklärt werden.
19 Frindte/Ben Slama/Dietrich/Pisoiu/Uhlmann/Kausch: Wege in die Gewalt.
Motivationen und Karrieren salafistischer Dschihadisten, HSFK-Report
1/2016.
Werte und Normen starke Gefühle von Homogenität und
Geborgenheit erzeugen. Darüber hinaus ist islamistischer
Fundamentalismus als eine gewaltbereite Ideologie zu
betrachten, welche zur Grundlage von Vorurteilen, negati-
ven Gefühlen und Gewaltbereitschaft gegenüber all jenen
werden kann, die diese Ideologie nicht befürworten.
Aber auch hier gilt: Fundamentalismus ist nicht gleich
Fundamentalismus. In unseren Studien zeigen sich zumin-
dest drei (statistische) Gruppierungen: Eine Gruppe von
Muslimen (42,8 Prozent der Gesamtstichprobe) ohne
ausgeprägte fundamentalistische Neigung und ohne poli-
tische Gewaltbereitschaft; weiterhin eine Gruppierung
(etwa 28,6 Prozent), in der wiederum ca. 20 fundamen-
talistische Überzeugungen äußern; und zuletzt eine Grup-
pierung (ebenfalls 28,6 Prozent der Gesamtstichprobe), in
der ca. die Hälfte der jungen Muslime starke fundamenta-
listische Überzeugungen, Vorurteile gegenüber Deutsch-
land und dem Westen und Hass und Wut auf den Westen
äußern.
Fazit
Es gibt keinen Grund, die Religiosität der Muslime per
se als problematisch anzusehen. Um einem islamistischen
Fundamentalismus vorzubeugen, sind allerdings gesell-
schaftliche Initiativen notwendig, die den Aufbau einer
positiven bikulturellen Identität erleichtern und einer kul-
tureller Entwurzelung entgegenwirken. Eine Demokratie
muss deshalb soziale Räume schaffen, um den Muslimen
sowohl eine Identifikation mit der deutschen Aufnah-
mekultur zu ermöglichen, als auch weiterhin eine posi-
tive Bindung an deren Herkunftskultur und Religion zu
gewährleisten.
Und die Muslime in Deutschland müssen deutlich
machen, dass sie die europäischen Werte der Aufklärung
im Allgemeinen und die politisch-rechtlichen Grundwerte
im Besonderen nicht nur akzeptieren, sondern auch mit-
gestalten wollen. Integration ist also ein wechselseitiger
Prozess, der nur bei gemeinsamem Engagement sowohl
der Migranten als auch der deutschen Mehrheitsbevölke-
rung gelingen kann. Dabei sollten sich sowohl die Mus-
lime als auch die „Mehrheitsgesellschaft“ nicht von Popu-
listen „vor sich hertreiben lassen“, die wechselseitig ein
negatives Zerrbild der jeweils anderen Gruppe vermitteln.
In Zeiten von Pegida und AfD keine ganz einfache Auf-
gabe.


















