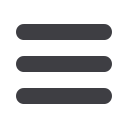

75
Politikfeld Wald
Einsichten und Perspektiven 4 | 16
tungen besitzen. In den Denkmustern der Befragten ist der
Wald untrennbar mit dem Förster verbunden. Drei von
zehn Befragten verwenden symbolische Vergleiche um
jeweils unzertrennliche Dinge zu beschreiben (Ein Wald
ohne Förster ist... „wie ein Topf ohne Deckel“, „Haus ohne
Dach“, „Fußballspiel ohne Schiedsrichter“ usw.).
Als Erklärungsansatz für diese Haltungen können wie-
der Überlegungen herangezogen werden, die bereits auf
den Widerspruch von Medienwelt und Erfahrungswelt
angewandt wurden. Die Dissonanz
21
zwischen der emp-
fundenen Gefährdung des Waldes und dem Erlebnis von
Wald wird vermieden, wenn Ängste und alle negativen
Vorstellungen an diese Person/Institution delegiert wer-
den. Diese Person/Institution versteht und teilt die Sorgen
und steht dafür ein, dass negative Entwicklungen imWald
in der eigenen Umgebung nicht Platz greifen können.
Reiht man die Leistungen, die von der Landnutzungs-
form Wald erbracht werden, nach ihrer Wahrnehmung
und nach zugeordneten Deutungsmustern, ergibt sich fol-
gendes Bild: Wald ist zunächst ein Raum sinnlicher Wahr-
nehmung und Erfahrung schlechthin und zugleich ein
zentrales Symbol für die Grundlagen des Lebens. Hierin
wurzelt die tiefe emotionale Wertschätzung des Waldes, die
ausgeprägte Sorge um seinen Zustand und die hohe Betrof-
fenheit gegenüber seiner Gefährdung und Schädigung.
Die Bereitstellung von Holz ist genuiner Bestandteil
des Symbols vomWald als Lebensgrundlage und wird har-
monisch in obiges Deutungsmuster eingefügt: Man nützt
dem Wald. Man verwertet „nur“ den einzelnen Baum-
stamm, nicht aber den Wald. Wird in Botschaften die
Nutzung zum Ziel erhoben (z.B. um Geld zu verdienen
oder Gewinn zu mehren), wirft das Sorgen auf und die
Deutungsmuster zeichnen Gefährdungslagen und Wald-
zerstörungen aus der medialen Welt nach, frei demMotto:
„Wald soll allen nutzen und es sollen nicht nur wenige von
seiner Ausbeutung profitieren“.
Der Hauptgrund für die Bevölkerung, Wald aufzusu-
chen, besteht offenkundig darin, spezifische Sinneserfah-
rungen zu erleben, um sich in dieser „waldtypischen“ (unse-
rer Zivilisation scheinbar so fernen) Atmosphäre zu erholen.
Der „Gesamtkomplex Wald“ und seine Wirkungen auf
alle fünf Sinne ist zusammen mit der prägenden Motivdi-
mension, „sich in der Natur zu bewegen“, entscheidend für
die Erholungswirkung des Waldes. Damit sind Wälder uner-
setzlich, weil sie aufgrund ihrer Struktur und flächenmäßi-
gen Präsenz ein (kostenfreies) Naturerlebnis ermöglichen, das
21 Vgl. Festinger (wie Anm. 19).
sonst keine andere Landnutzungsform erreicht. Aufgrund
seiner räumlichen Verteilung und Häufigkeit ist der Wald in
der individuellen gesellschaftlichen Wahrnehmung dabei all-
gegenwärtig, nie ganz fern. Wald ist somit eine kollektive
gemeinsame Erfahrung innerhalb unserer Gesellschaft.
Diskussionen hinsichtlich der Erholungsfunktion von
Wäldern können daher auf die Frage nach Wegeführung
und -gestaltung von Spazier-, Rad- und Wanderwegen
fokussiert werden. Für die Waldbewirtschaftung selbst
besteht ein großer Freiraum, wenn abwechslungsreiche
Waldbilder geschaffen werden und nicht der Eindruck
entsteht, dass die Wälder wirtschaftlich ausgenutzt oder
vernachlässigt werden.
Holznutzung oder Flächenstilllegung – ein zentrales
Konfliktfeld im Umgang mit demWald
22
In der öffentlichen Kommunikation konkurrieren gegen-
wärtig zwei zentrale Erzählungen, die sich um das Poli-
tikfeld Forstwirtschaft und Naturschutz ranken und auf
unterschiedlichen Ebenen zu Konflikten führen.
Im Naturschutzdiskurs wird der gegenwärtige Waldzu-
stand als vorrangig negativ beschrieben und als Problem dar-
gestellt. Dabei werden Handlungen vorgeschlagen, die einen
zukünftigen positiven Zustand im Sinne des Naturschutzes
herstellen sollen, also das Problem lösen. Der Wald und
seine natürlichen Prozesse seien „in Gefahr“ und bedürften
dringend des Schutzes. Die forstliche Nutzung verandere das
Okosystem negativ und müsse dringend modifiziert werden.
Diese Argumentation ist an die gesellschaftliche Vorstellung
der gefahrdeten Restnatur sehr gut anschlussfahig. Zent-
rale Symbole sind rote Listen oder die Entdeckung ausge-
storbener Arten in ungenutzten Waldbereichen.
Auf der anderen Seite wird imForstwirtschaftsdiskurs der
gegenwartige Zustand als positiv angesehen: Eine drohende
Verschlechterung, zum Beispiel durch Flachenstilllegungen
oder Nutzungseinschrankungen, soll verhindert werden.
Diese Haltung wendet sich mithin gegen Veränderun-
gen und zielt auf den Erhalt des Status quo ab. Aufgrund
einer zunehmenden Entfremdung der Menschen von der
Primarproduktion – eine Errungenschaft der arbeitstei-
ligen Gesellschaft – ist diese Argumentation nur bedingt
an gesellschaftliche Vorstellungen anknupfungsfahig. Als
wichtige Symbole werden gegenwärtig die Ergebnisse der
Bundeswaldinventur gesehen, die eine „positive“ Entwick-
lung der Walder zu mehr Naturnahe verdeutlichen.
22 Vgl. Günther Dobler/Michael Suda: Der Held und der Bosewicht. Wie
Greenpeace und andere uns von Gut und Bose erzahlen, in: LWF aktuell
(2013), H. 97, S. 48–53.


















