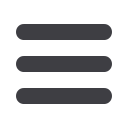
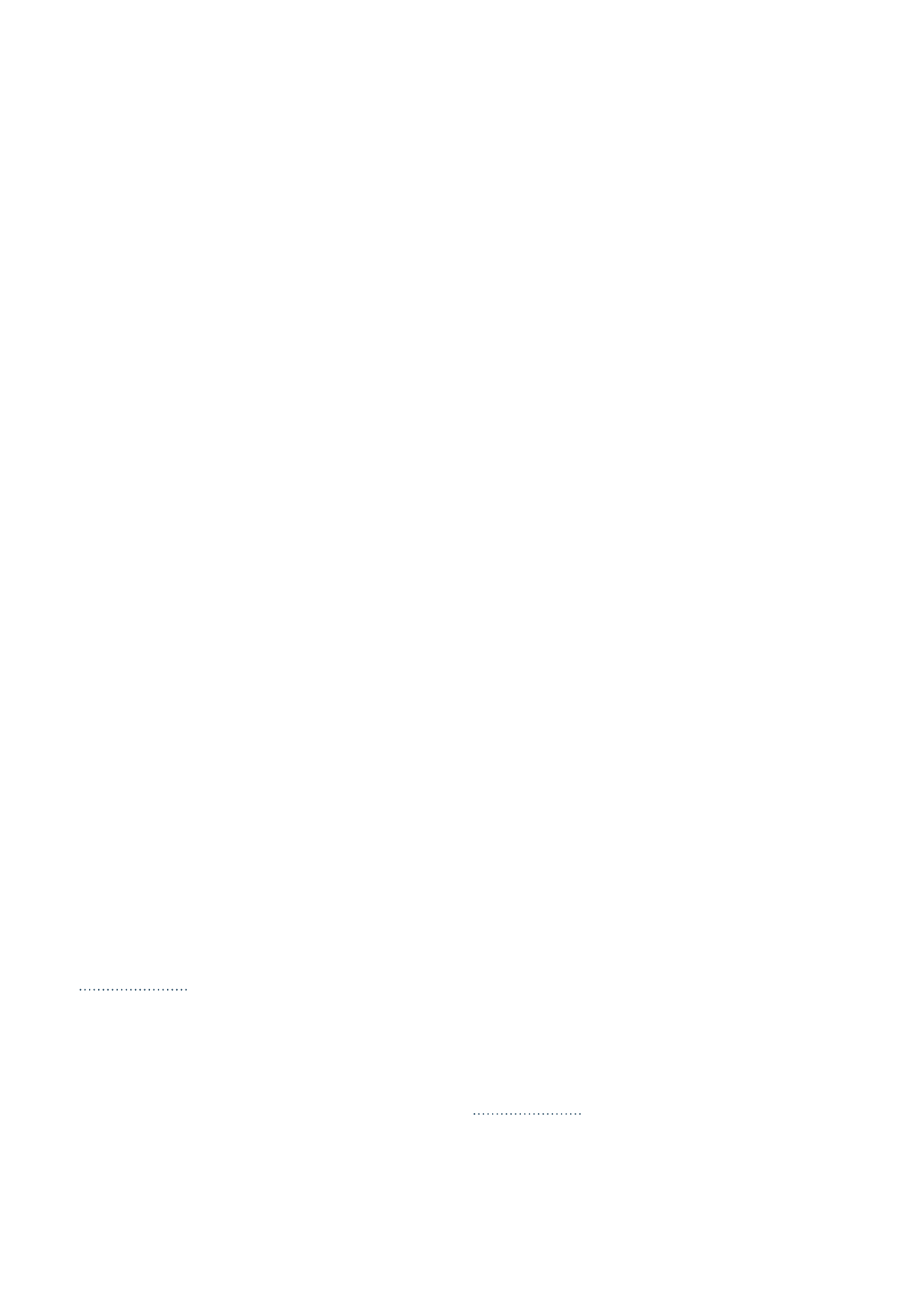
24
Einsichten und Perspektiven 3 | 17
len Erhebungen eine große Bedrohung für den Fortbe-
stand des Imperiums sah.
34
Scheinkonstitutionalismus
Angesichts der nicht abebbenden Protestwelle musste
das Zarenregime 1905 um sein Überleben kämpfen. Die
enorme Zunahme politisch motivierter Gewalt verdeut-
lichte, dass sich allein mit polizeistaatlicher und militäri-
scher Repression die Lage nicht wieder dauerhaft in den
Griff kriegen ließ. Um den Unruhen den Schwung zu
nehmen, sah sich die Regierung gezwungen, partiell auf
die Forderungen der liberalen Opposition einzugehen.
Lange schwankte Nikolaj II., wie weit er mit seinen Zuge-
ständnissen den gesellschaftlichen Forderungen entgegen-
kommen wollte. Als aber im September 1905 ein weiterer
Generalstreik ausgerufen wurde und die Lage vollends zu
kippen drohte, ließ sich die Entscheidung nicht mehr auf-
schieben.
35
Als Staatsmann von Format, der sowohl in Regierungs-
kreisen als auch in der liberalen Gesellschaft Ansehen
genoss, warnte der vormalige Finanzminister Sergej Witte
(1849-1915) am 9. Oktober Nikolaj II. in schonungslo-
ser Offenheit vor dem Schlimmsten: Der Untergang der
Monarchie stehe bevor, weil es längst zu einem „gestör-
ten Gleichgewicht“ zwischen Gesellschaft und dem beste-
henden autokratischen Regime gekommen sei. Russland
sei „über das bestehende System“ längst hinausgewach-
sen und benötige nun eine „auf bürgerlichen Freiheiten
begründete Ordnung“. Falls Nikolaj II. dazu nicht bereit
sei, bleibe nur die Alternative einer Militärdiktatur, auf die
das Zarenregime aber kaum vorbereitet und deren politi-
scher Ausgang daher völlig ungewiss sei.
36
Am 17. Oktober hatte Nikolaj II. endlich ein Einsehen
und verkündete das von Witte ausgearbeitete sogenannte
Oktobermanifest. Das sah die Einführung eines Zweikam-
merparlaments vor, bestehend aus einem Staatsrat und der
neu zu bildenden Reichsduma, der eigentlichen Volksver-
tretung. Darüber hinaus gewährte das Oktobermanifest
bürgerliche Grundrechte, darunter Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit. Das ermöglichte es, dass in der Folgezeit
im Zarenreich eine freie Presse entstand. In den über 500
Zeitungen fanden bald stürmische gesellschaftliche Diskus-
sionen statt. Zugleich durften sich Parteien, Gewerkschaf-
34 Zu den militärischen Strafaktionen vgl. Kusber (wie Anm. 12), S. 71-89.
35 Ascher (wie Anm. 14), S. 211-223.
36 Ebd., S. 224-226; Figes (wie Anm. 1), S. 205-208; Enticott (wie Anm. 13),
S. 37-50.
Diese restriktive Nationalitätenpolitik verstärkte die Spreng-
kraft sozialer und politischer Konflikte und setzte damit in
den Randgebieten besondere Eskalationsdynamiken frei.
Von den zwischen 1895 bis 1900 stattfindenden 59 großen
Straßendemonstrationen fanden lediglich drei in den rus-
sischen Kerngebieten statt, dagegen 25 in den polnischen
Westgebieten, jeweils neun in den Ostseeprovinzen und in
der Ukraine, sieben inWeißrussland und sechs in Finnland.
Auch die Bauernunruhen während der Zeit von 1902 bis
1904 erfassten im besonderen Maße ukrainische Gebiete
und im Kaukasus vor allem Georgien.
31
Zwar wurden 1905 nicht alle Regionen im gleichen
Maß von der Revolutionswelle erfasst; dennoch zeigten
die in Polen und im Baltikum besonders heftig toben-
den Unruhen, wie stark das Russische Imperium an sei-
nen Rändern schon zu brodeln und bröckeln begonnen
hatte. Die Wucht der Revolution resultierte hier daraus,
dass sich der nationale Impuls mit sozialen Forderungen
von Bauern und Arbeitern sowie mit den politischen For-
derungen der liberalen Intelligenz verband. Während der
beiden Jahre von 1905 und 1906 gab es allein in Polen
7000 Streiks, an denen 1,3 Mio. Arbeiter teilnahmen. In
Warschau geboten schließlich Armeeverbände mit Waf-
fengewalt dem bald bürgerkriegsähnlichen Treiben Ein-
halt.
32
Im Baltikum brannten die aufständischen Bauern
besonders viele Adelsgüter nieder.
33
Bei den darauffol-
genden Strafexpeditionen gingen die zarische Armee
und Geheimpolizei gnadenlos vor und töteten in den
Ostseeprovinzen 2000 Menschen. Weitere 600 wurden
anschließend in Gerichtsprozessen noch zum Tode verur-
teilt und tausende Andere zur Zwangsarbeit nach Sibirien
verbracht. Von allen nach 1905 im gesamten Russischen
Reich ausgesprochenen Todesurteilen entfielen 15 Pro-
zent auf das Baltikum und ein Viertel auf Polen. Diese
unverhältnismäßig hohe Zahl dokumentierte nicht nur
die revolutionären Energien in den Westgebieten, sondern
auch, dass die Petersburger Regierung in diesen nationa-
31 Kappeler (wie Anm. 23), S. 268.
32 Rolf (wie Anm. 27), S. 325-374; Christoph Gumb: Repräsentationen von
Herrschaft und die Präsenz der Gewalt, Warschau (1904-1906), in: Jörg
Baberowski/David Feest/Christoph Gumb (Hg.): Imperiale Herrschaft in
der Provinz. Repräsentationen politischer Macht im späten Zarenreich,
Frankfurt am Main 2008, S. 271-302.
33 Zum Jahr 1905 im Baltikum vgl. Detlef Henning: Die Revolution von 1905
in den „Deutschen Ostseeprovinzen Russlands“, ihre Ursachen und Be-
deutung, in: Kusber/Frings (wie Anm. 15), S. 247-260; James D. White:
The 1905 Revolution in Russia’s Baltic Provinces, in: Jonathan D. Smele/
Anthony Heywood (Hg.): The Russian Revolution of 1905. Centenary Per-
spectives, London/New York 2005, S. 55-78.
Der Russische Revolutionszyklus, 1905-1932


















