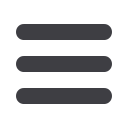
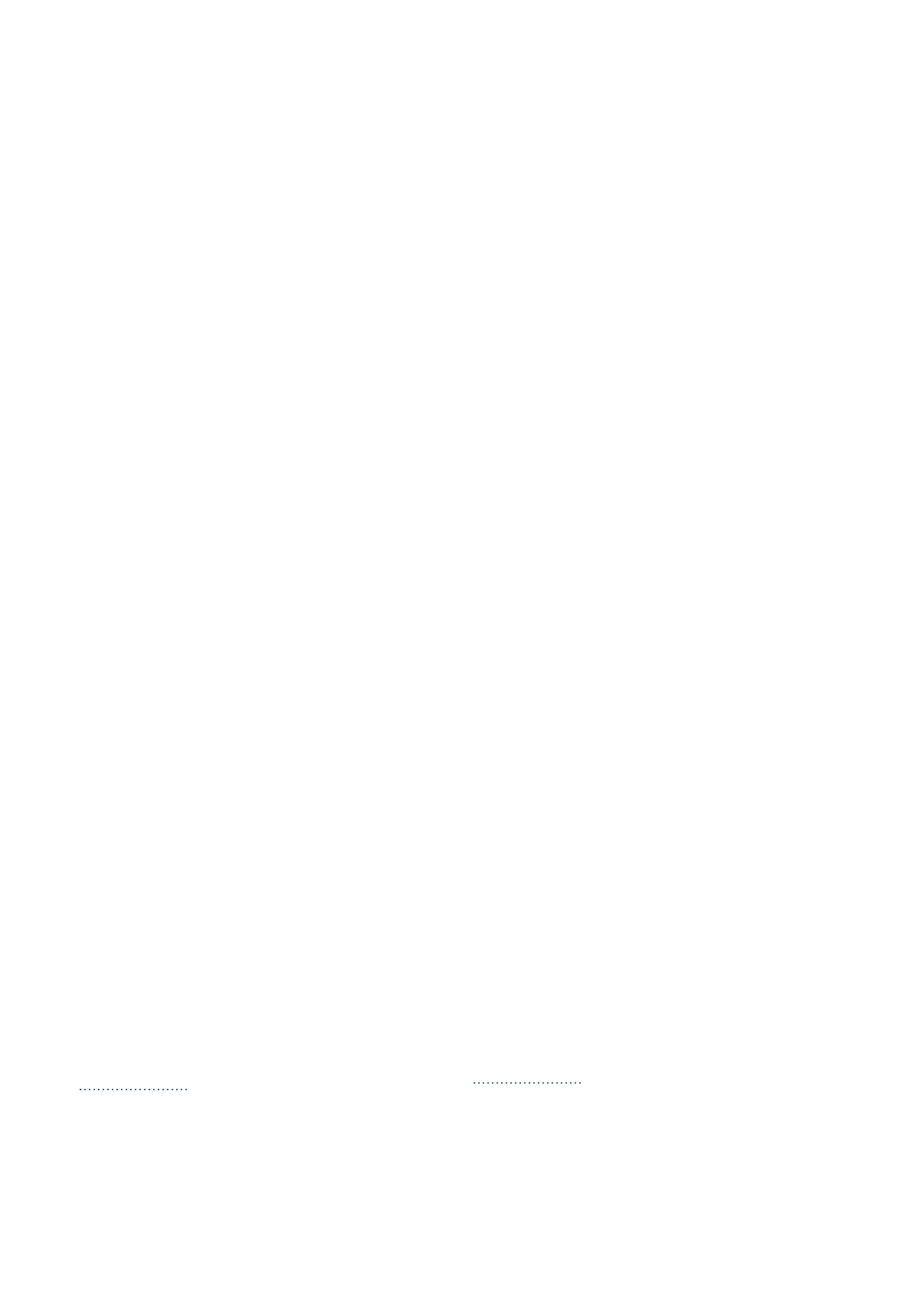
22
Einsichten und Perspektiven 3 | 17
Ganz im Gegenteil: Anlässlich der Krönungszeremonie von
Nikolaj II. 1896 schrieb die russische Zeitung Novoe Vremja
(Die Neue Zeit), die enorme Diversität der Kulturen und die
beeindruckende Vielfalt unterschiedlichster Ethnien stelle
einen besonderen Reichtum dar und sei die Quelle natio-
nalen und imperialen Stolzes.
24
Nachdem sich Russland in
seinem Expansionsprozess an seinen Rändern neue Gebiete
einverleibt hatte, kam es zu einer Kooperation mit den dorti-
gen Eliten, deren Angehörige sodann vielfach im Zarenstaat
Karriere machten. Die Petersburger Reichselite war daher
multiethnisch zusammengesetzt, dabei mit einem besonders
hohen Anteil der Baltendeutschen und anderer Deutsch-
stämmiger. Als nach 1864 die Expansion des Russischen
Imperiums nach Zentralasien begann, stieg beispielsweise
Konstantin von Kaufmann (1818-1882) zur zentralen Figur
auf und bestimmte bis 1882 die zarische Kolonialpolitik im
neu entstehenden Generalgouvernement Turkestan. Es wäre
demnach verfehlt, von den Russen als alles dominierendes
Reichsvolk zu sprechen.
25
Spätestens mit den „Großen Reformen“ der 1860er Jahre
war eine neue Dynamik in das Reichsgefüge gekommen.
Die nun verfolgte moderne Staatlichkeit erhob einen
weit intensiveren Herrschaftsanspruch. Die bürokrati-
sche Modernisierung ging mit Prozessen der Systematisie-
rung und Unifizierung einher. Das stellte die überlieferte
Ordnung des vormodernen Vielvölkerreichs mit ihren
besonderen Arrangements in Frage. Ferner diente stärker
als zuvor das Russische fortan als der Klebstoff, der das
Zarenreich in aller seiner soziokulturellen Unterschied-
lichkeit zusammenhalten sollte. Die Moderne und der
Fortschritt, das Imperiale und das Staatliche kamen nun
immer mehr in der Form des Russischen zum Ausdruck.
Während aber Petersburg auf die Festigung der Reichs-
einheit drängte, entstanden in den nichtrussischen Peri-
pherien erste Formen einer nationalen Identität. Die
wachsenden nichtrussischen Bildungsschichten began-
nen, sich ihre Traditionen bewusst zu machen und durch
die Identifizierung mit der eigenen Kultur sowie Sprache
ständeübergreifende Prozesse der Nationswerdung anzu-
stoßen. Als emotionale Bindekraft, die mittels geteilter
Wir-Gefühle politische Großkollektive schaffen konnte,
entfaltete der Nationalismus in der Zeit, in der sich die
24 Zit. n. Mark D. Steinberg: The Russian Revolution 1905-1921, Oxford
2017, S. 233.
25 Ulrich Hofmeister: Der Halbzar von Turkestan: Konstantin fon-Kaufman
in Turkestan, 1867-1882, in: Tim Buchen/Malte Rolf (Hg.): Eliten im Viel-
völkerreich: imperiale Biographien in Russland und Österreich-Ungarn
(1850-1918), München 2015, S. 65-89.
Agrar- in eine industrialisierte Massengesellschaft trans-
formierte, eine große Faszination. Er versprach, die neuen
gesellschaftlichen Selbstfindungs- und Orientierungsbe-
dürfnisse zu erfüllen. Mit seinen massenmotivierenden
Energien trug das Bekenntnis zur imaginierten Willens-
und Kulturgemeinschaft der Nation das Potenzial in sich,
an die Stelle des russisch dominierten Reichspatriotismus
zu treten. Das Imperiale und das Nationale gerieten damit
in einen politischen Wettbewerb.
26
Das Spannungsverhältnis zwischen modernem Empire
Building und Nation Building bestimmte vor allem die
politischen Entwicklungen in den westlichen Landes-
teilen. Nachdem Polen im Zuge von drei Teilungen zwi-
schen 1772 und 1795 seine Eigenständigkeit verloren hatte
und seine Territorien Preußen, dem Habsburger und dem
Zarenreich zugeschlagen worden waren, schloss die Peters-
burger Regierung 1815 die im Russischen Reich befindli-
chenTeilungsgebiete zum formal unabhängigen Königreich
Polen (auch „Kongresspolen“ genannt) zusammen. Trotz
dieser staatsrechtlichen Sonderstellung formierten sich im
polnischen Adel, in der Studentenschaft Warschaus und in
städtischen Bürgerkreisen schnell Gruppierungen, die sich
gegen die zarischen Autoritäten auflehnten. Die gärenden
Unruhen eskalierten 1863 schließlich in einem bewaffneten
Aufstand. Er wurde allerdings von russischen Verbänden
schnell niedergeschlagen, weil es den meist adlig-bürgerli-
chen Aufständischen nicht gelang, die polnischen Bauern
für die gemeinsame nationale Sache zu gewinnen.
27
Die sogenannte „polnische Meuterei“ schuf in Russland
das Bild von den untreuen Polen und provozierte harte
Gegenmaßnahmen. Die polnischen Gebiete wurden zu
einer einfachen Provinz, dem sogenannten Weichselland
zurückgestuft. Wichtige politische und administrative
Ämter übernahmen nun zugereiste nichtpolnische Beamte.
Zusammen mit der personellen Depolonisierung verfügte
die Petersburger Regierung, dass 1865 Russisch als Verwal-
tungssprache durchgesetzt und 1869 auch das polnische
Schul- und Universitätswesen russifiziert wurde.
28
Von einer repressiven Nationalitätenpolitik waren neben
den Polen vor allem Ukrainer und Weißrussen betroffen.
Die Petersburger Eliten nahmen Großrussland, Weißruss-
land und die als Kleinrussland bezeichnete Ukraine als eine
26 Dietmar Neutatz: Träume und Alpträume. Eine Geschichte Russlands im
20. Jahrhundert, München 2013, S. 42-49.
27 Malte Rolf: Imperiale Herrschaft im Weichselland. Das Königreich Polen im
Russischen Imperium (1864-1915), München 2015, S. 25-38; Dietrich Bey-
rau: Krieg und Revolution. Russische Erfahrungen, Paderborn 2017, S. 54-68.
28 Rolf (wie Anm. 27), S. 39-180; Beyrau (wie Anm. 27), S. 68-75.
Der Russische Revolutionszyklus, 1905-1932


















