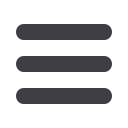

13
Die Bayerische Verfassung in der Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
chen Gesetzbuch – beruhen. Diese Entscheidungen können
etwa Schadensersatzansprüche nach einem Verkehrsunfall
oder einer fehlerhaften Kapitalanlageberatung, das Beste-
hen eines Deckungsschutzanspruchs gegen eine Rechts-
schutzversicherung oder eine Auseinandersetzung von
Mitgliedern einer Wohnungseigentümergemeinschaft zum
Gegenstand haben. Wie bereits erwähnt, kann der Verfas-
sungsgerichtshof derartige Gerichtsentscheidungen nicht
uneingeschränkt am Maßstab der Bayerischen Verfassung
überprüfen. Grund hierfür ist, dass die bundesrechtli-
chen Rechtsvorschriften, die den Gerichtsentscheidungen
zugrunde liegen, der Bayerischen Verfassung im Rang vor-
gehen. Die Prüfung des Bayerischen Verfassungsgerichts-
hofs beschränkt sich daher in materieller Hinsicht darauf,
ob das Gericht willkürlich gehandelt hat. Das ist nur der
Fall, wenn es sich von objektiv sachfremden Erwägungen
hat leiten lassen und sich damit außerhalb jeder Rechts-
anwendung gestellt, seiner Entscheidung in Wahrheit also
gar kein Recht zu Grunde gelegt hat. Außerdem prüft der
Verfassungsgerichtshof Entscheidungen, die in einem bun-
desrechtlich geregelten Verfahren ergangen sind, daraufhin
nach, ob ein Verfahrensgrundrecht der Bayerischen Verfas-
sung verletzt ist, das – wie z.B. das rechtliche Gehör – mit
gleichem Inhalt im Grundgesetz gewährleistet ist.
Vor diesem Hintergrund betreffen die meisten Entschei-
dungen in Verfassungsbeschwerdeverfahren das Grund-
recht auf rechtliches Gehör oder das Willkürverbot. In den
vergangenen fast 70 Jahren hat sich auf diese Weise eine
sehr ausdifferenzierte Rechtsprechung des Verfassungs-
gerichtshofs zur Gewährleistung des rechtlichen Gehörs
und zu den sehr strengen Voraussetzungen für das Vorlie-
gen eines Willkürverstoßes herausgebildet. Dabei bestehen
weitgehende Übereinstimmungen zwischen der Rechtspre-
chung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und der des
Bundesverfassungsgerichts.
Insgesamt haben nur sehr wenige Verfassungsbeschwer-
den Erfolg, nämlich zwei bis drei Prozent. Das liegt vor
allem daran, dass viele Beschwerdeführer den Verfassungs-
gerichtshof zu Unrecht für eine weitere Fachinstanz halten.
Der Verfassungsgerichtshof ist aber kein Rechtsmittel-
gericht, keine Superrevisionsinstanz. Die Richtigkeit der
tatsächlichen Feststellungen, der Auslegung des Rechts im
Rang unter der Verfassung und der Anwendung auf den
konkreten Fall ist nicht Sache der Verfassungsgerichtsbar-
keit. Trotz der geringen Erfolgsquote, die im Übrigen auch
für Verfassungsbeschwerden zum Bundesverfassungsgericht
gilt, ist das Institut der Verfassungsbeschwerde keineswegs
überflüssig. Man sollte nicht unterschätzen, dass Verfas-
sungsbeschwerden – selbst wenn sie letztlich erfolglos blei-
ben – eine gewisse Ventilfunktion haben und dass allein das
Bestehen einer Verfassungsklagemöglichkeit zur strengen
Beachtung der Grundrechte durch die Gerichte beiträgt.
Verfassungsbeschwerden gegen Gerichtsentscheidun-
gen geben heute nur selten Anlass zu einer Verfassungsin-
terpretation durch den Verfassungsgerichtshof. Hier geht
es weniger um die Interpretationsfunktion, sondern eher
um die Verteidigung der Verfassung. Es ist eine wichtige
Aufgabe des Verfassungsgerichtshofs, die Verfassung und
ihre Beachtung im täglichen Leben zu schützen. Dazu
muss er die Einhaltung der verfassungsmäßigen Schran-
ken garantieren, die der öffentlichen Gewalt, und zwar
auch den anderen Staatsorganen, im Verhältnis zum Bür-
ger gezogen sind. Schlagwortartig lässt sich diese Aufgabe
des Verfassungsgerichtshofs mit der eines „Hüters der Ver-
fassung“ umschreiben.
Manchen Verfassungsbeschwerden kommt allerdings
durchaus eine über den Einzelfall hinausgehende, richtung-
weisende Bedeutung zu. Der Verfassungsgerichtshof hatte
zum Beispiel im November 2014 über eine Verfassungs-
beschwerde gegen die Einsetzung eines parlamentarischen
Untersuchungsausschusses zu entscheiden. Der Bayerische
Landtag hatte die Einsetzung eines Untersuchungsaus-
schusses beschlossen – im Folgenden wörtlich zitiert – „zur
Untersuchung eines möglichen Fehlverhaltens bayerischer
Polizei- und Justizbehörden einschließlich der zuständigen
Staatsministerien, der Staatskanzlei und der politischen
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger im
Zusammenhang mit dem Labor […] und der beim Bay-
erischen Landeskriminalamt eingesetzten Sonderkommis-
sion ‚Labor‘“.
Obwohl der Einsetzungsbeschluss damit das Verhalten
staatlicher Stellen zum Gegenstand der Untersuchung
erklärt, sahen sich die Beschwerdeführer – der Inhaber des
Labors und seine Ehefrau – durch die einzelnen Fragen
und Fragenkomplexe des Einsetzungsbeschlusses unter
anderem in ihren Grundrechten auf den gesetzlichen
Richter und des Verbots der Doppelbestrafung verletzt.
Die im Einsetzungsbeschluss formulierten Fragen zielten
nach Auffassung der Beschwerdeführer teilweise auf eine
inhaltliche Überprüfung rechtskräftiger strafgerichtlicher
Entscheidungen und teilweise auf die Beeinflussung eines
laufenden Strafverfahrens.
Da sich die Verfassungsbeschwerde hier (ausnahms-
weise) nicht gegen eine bundesrechtlich geprägte gericht-
liche Entscheidung richtete, sondern die Einsetzung des
Untersuchungsausschusses auf der Grundlage bayerischen
Landesrechts erfolgte, konnte der Verfassungsgerichtshof
diese ohne die oben dargelegten Einschränkungen am


















