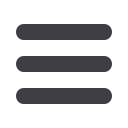

14
Die Bayerische Verfassung in der Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
Maßstab aller als verletzt gerügten, in der Bayerischen Ver-
fassung verbürgten Grundrechte prüfen. Er hat die Verfas-
sungsbeschwerde abgewiesen und ausgeführt, dass weder
das allgemeine Persönlichkeitsrecht noch Verfahrensgrund-
rechte einer Befassung des Parlaments mit Angelegenheiten
entgegenstehen, die auch Gegenstand von Strafverfahren
sind oder waren. Die parlamentarische und die gerichtli-
che Sachaufklärung seien auf unterschiedliche Ziele gerich-
tet. Soweit die Fragestellungen des Einsetzungsbeschlusses
abgeschlossene gerichtliche Verfahren betreffen, sei er nicht
darauf gerichtet, die in diesen Verfahren ergangenen rechts-
kräftigen Entscheidungen infrage zu stellen. Mit Blick auf
ein laufendes Strafverfahren hat der Verfassungsgerichts-
hof allerdings deutlich gemacht, dass der Untersuchungs-
ausschuss nicht auf diesen Prozess einwirken oder dessen
Ergebnis durch eigene strafbarkeitsbezogene Bewertungen
vorwegnehmen dürfe. Bei der Durchführung der Untersu-
chung müsse daher zwingend beachtet werden, dass eine
strafrechtliche Einzelfallwürdigung vom Untersuchungs-
auftrag des Landtags nicht mehr gedeckt wäre. Auch dürf-
ten die für das laufende Strafverfahren zuständigen Richter
nicht dazu verpflichtet werden, ihre verfahrensleitenden
Entscheidungen gegenüber dem Untersuchungsausschuss
schriftlich oder mündlich in irgendeiner Weise zu erläutern.
3. Organ- oder Verfassungsstreitigkeiten
Verfassungsbeschwerden gegen Einzelfallentscheidungen
der Gerichte und Behörden sowie Popularklagen gegen
Rechtsnormen – das sind die Verfahrensarten, die auch
einzelne Bürgerinnen und Bürger einleiten können. In
den übrigen Verfahren können Anträge meist nur von
Staatsorganen oder Teilen davon gestellt werden, das heißt
zum Beispiel vom Landtag, von Landtagsabgeordneten,
von der Staatsregierung. Solche Verfahren gibt es zwar von
der Zahl her wenige, das einzelne Verfahren hat aber oft
große politische Bedeutung, stößt auf reges öffentliches
Interesse und kann viel Arbeit verursachen. Vor allem sind
hier die Organ- oder Verfassungsstreitigkeiten zu nennen.
In diesen Verfahren geht es in erster Linie um Streitig-
keiten innerhalb des Staatsgefüges, also grob gesagt darum,
ob ein oberstes Staatsorgan durch ein anderes in seiner
verfassungsrechtlichen Stellung verletzt wird. Gegenstand
eines Organstreits kann zum Beispiel die Frage sein, ob
die Staatsregierung unter Verstoß gegen die Verfassung in
Rechte des Landtags eingegriffen hat. Auch innerhalb eines
obersten Staatsorgans kann es zu einem Organstreit kom-
men, etwa zu der Frage, ob die Mehrheitsfraktion des Land-
tags Minderheitenrechte der anderen Fraktionen verletzt
hat. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof muss durch
seine Entscheidung dafür sorgen, dass das Zusammenspiel
zwischen den Staatsorganen nach den Spielregeln der Ver-
fassung abläuft. Gleichzeitig ist in Organ- oder Verfassungs-
streitigkeiten häufig die Interpretationsfunktion des Verfas-
sungsgerichtshofs gefragt, weil die Verfassung die Stellung
der Staatsorgane zueinander nur in den Grundsätzen regelt
und somit oft ausfüllungsbedürftig ist.
So musste sich der Verfassungsgerichtshof in Organ-
streitverfahren mehrfach mit der Frage auseinandersetzen,
ob die Staatsregierung parlamentarische Anfragen von
Oppositionsfraktionen des Bayerischen Landtags ausrei-
chend beantwortet hat. Der Ausgangspunkt für die Lösung
dieser Streitfälle ist klar. Zu den wichtigsten Aufgaben des
Landtags gehört die Kontrolle der Staatsregierung. Um die
für die Kontrolle erforderlichen Informationen gewinnen
zu können, besteht ein parlamentarisches Fragerecht. Die
Staatsregierung ist dementsprechend verpflichtet, Anfragen
des Landtags zu beantworten. Der Verfassungstext enthält
hierzu jedoch keine näheren Regelungen, etwa über den
Umfang der Antwortpflicht. In Art. 13 Abs. 2 ist ledig-
lich der Grundsatz der Unabhängigkeit des Abgeordneten
festgelegt. Speziell zu den Rechten der parlamentarischen
Opposition ist dem Art. 16 a Folgendes zu entnehmen:
„(1) Parlamentarische Opposition ist ein grundlegen-
der Bestandteil der parlamentarischen Demokratie.
(2) Die Fraktionen und die Mitglieder des Landtags,
welche die Staatsregierung nicht stützen, haben das Recht
auf ihrer Stellung entsprechende Wirkungsmöglichkeiten
[…]“
Der Verfassungsgerichtshof hat die Aufgabe, auf der
Grundlage dieser allgemein gehaltenen Verfassungsbe-
stimmungen im Einzelfall festzustellen, ob bestimmte par-
lamentarische Anfragen ausreichend beantwortet wurden.
Er gibt dadurch gleichzeitig Leitlinien für die Beantwor-
tung künftiger Anfragen. Allein im Jahr 2014 hatte der
Verfassungsgerichtshof drei solcher Organstreitverfahren
wegen parlamentarischer Anfragen zu entscheiden.
Im ersten dieser Verfahren trugen die Antragsteller vor,
die Staatsregierung habe eine Reihe von Anfragen zur
Tätigkeit des Bayerischen Landesamts für Verfassungs-
schutz nicht hinreichend beantwortet. Die Entscheidung
des Verfassungsgerichtshofs vom 20. März 2014 ent-
hält allgemeine Feststellungen zum Umfang und zu den
Grenzen der Auskunftspflicht der Staatsregierung, gerade
auch mit Blick auf den Geheimnisschutz. Die Pflicht zur
Beantwortung parlamentarischer Anfragen entfalle nicht
dadurch, dass das Staatsministerium des Innern bereits
dem – geheim tagenden – Parlamentarischen Kontrollgre-
mium über die Tätigkeit des Landesamts für Verfassungs-


















