
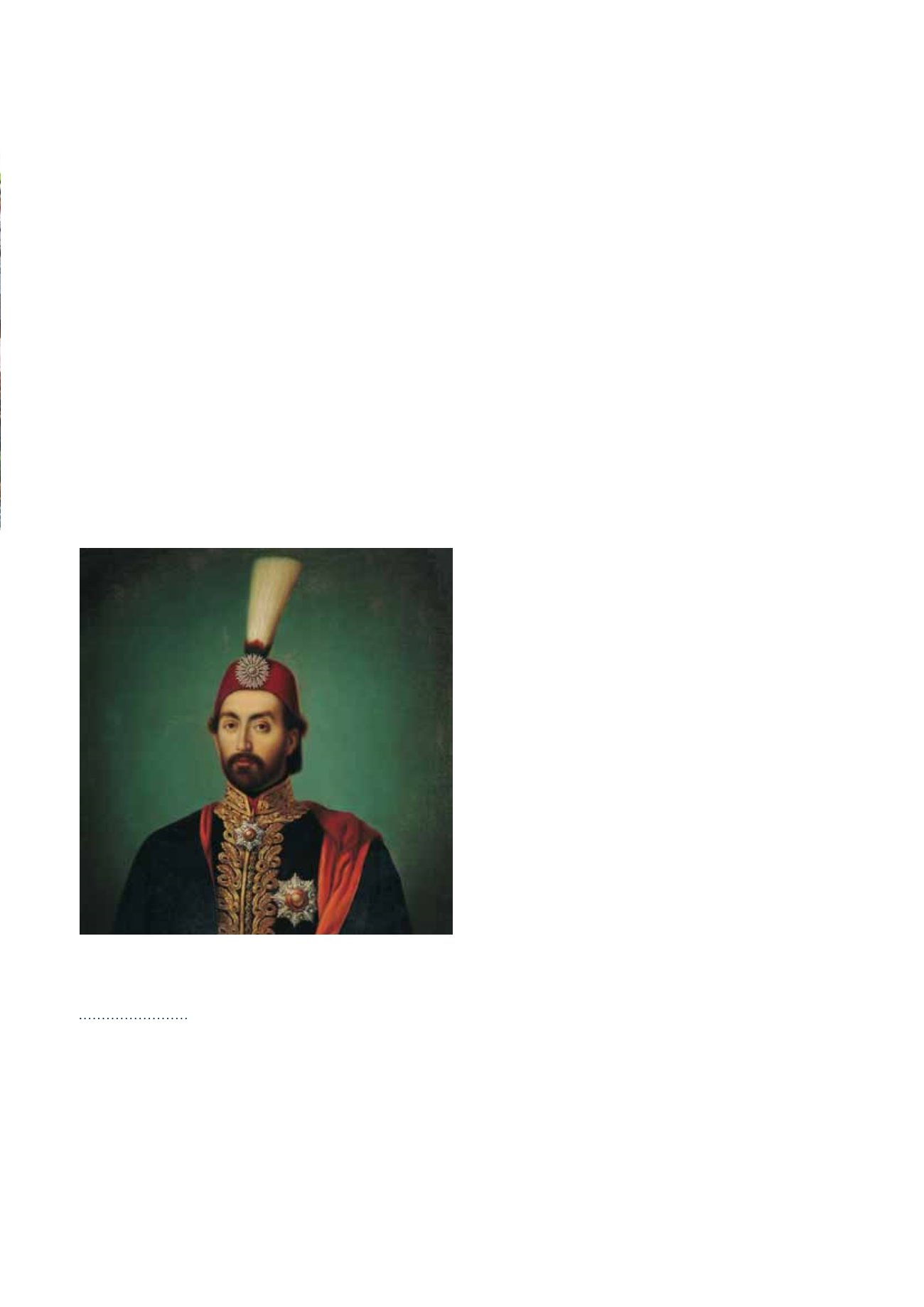
63
Die Türkei 2015: Atatürks Albtraum
Einsichten und Perspektiven 4 | 15
Schwäche des Osmanischen Reichs offenbarte sich schließ-
lich 1683 im zweiten Versuch, Wien zu erobern, was in
einer empfindlichen Niederlage endete und die europäi-
schen Mächte dazu veranlasste, die Osmanen an mehreren
Fronten anzugreifen. In der Folge mussten schwere Nieder-
lagen und Gebietsabtretungen hingenommen werden.
Zunehmend sah sich der Vielvölkerstaat neben seinen
strukturellen Schwierigkeiten schließlich auch einem neuen
Feind ausgesetzt: dem in Europa erstarkenden und auch
in andere Regionen ausgreifenden Nationalismus. „Der
kranke Mann am Bosporus“, wie der Osmanische Staat
von europäischen Medien verspottet wurde,
6
kämpfte an
mehreren inneren Fronten mit Unabhängigkeitsbewegun-
gen – zum Beispiel der Serben und der Griechen – und
musste weitere Gebiete abtreten. Unter dem Schlagwort
„Orientalische Frage“ wurde unter den europäischen Mäch-
ten immer offener über die Zukunft des Reichs und eine
mögliche Zerschlagung seines Herrschaftsgebiets diskutiert.
Sultan Abdülmecid I. Mitte des 19. Jahrhunderts, gemalt von einem unbe-
kannten Künstler
Bild: ullstein bild/Heritage images/Fineart images
6 Dieses sprachliche Bild wurde erstmals von Zar Nikolaus I. verwendet, der in
einem Gespräch mit dem britischen Botschafter 1852 damit den herrschenden
Sultan Abdülmecid I. charakterisierte: „Wir haben […] einen kranken Mann auf
den Armen, es wäre ein Unglück, wenn er uns eines Tages entfallen sollte.“
Zit. nach Gerhard Herm: Der Balkan. Das Pulverfaß Europas, Düsseldorf 1993,
S. 278. Dass das Osmanische Reich trotz aller tatsächlicher und vermeintlicher
Andersartigkeiten als integraler Bestandteil Europas wahrgenommen wurde,
veranschaulichen die in Großbritannien und Frankreich geläufigen Pendants
zum hierzulande sprichwörtlichen „kranken Mann am Bosporus“:
„the Sick
Man of Europe“
und
„l’Homme Malade de l’Europe“.
Vgl. M. Şükrü Hanioğlu:
Atatürk. Visionär einer modernen Türkei, Darmstadt 2015, S. 202.
Innerhalb des Osmanischen Reichs setzte zu Ende der
1830er in der Regierungszeit Abdülmecids I. eine Reform-
ära ein, die unter dem Namen
Tanzimat-ı Hayriye
(„Heil-
same Neuordnung“) in die türkische Geschichte einging.
Sie zielte vor allem darauf ab, das Reich im Inneren zu
befrieden und scheute auch vor umfangreichen Zuge-
ständnissen nicht zurück: Die Nichtmuslime im Land
wurden mit den Muslimen gleichgestellt, das Justiz- und
Steuersystem wurden reformiert. Den wirtschaftlichen
Problemen wurde man damit allerdings nicht Herr und
auch der nationalistische Gedanke ließ sich nicht einfach
wieder aus der Welt schaffen: Die Unruhen auf dem Bal-
kan hielten an.
Der Balkan als „Pulverfass“
Im Inneren war Sultan Abdülhamid II., der durch einen
Staatsstreich die Regentschaft erlangt hatte, bemüht, sich
reformbereit zu zeigen: Er versprach sogar eine Liberali-
sierung der Verfassung, die ein parlamentarisches Regie-
rungssystem einführen sollte. Die Pforte jedoch über-
warf sich mit dem russischen Zarenreich – ein Krieg und
Gebietsabtretungen folgten. Das russische Bestreben, zwei
bulgarischen Provinzen sowie Bosnien und Herzegowina
die Autonomie zuzugestehen, lehnte die Pforte ab, wor-
aufhin der Zar den Krieg erklärte, den europäischen Teil
des Osmanischen Reichs besetzte und gefährlich auf Istan-
bul vorrückte. Die militärische Stärke der Russen zwang
den Sultan dazu, im Januar 1878 um Frieden zu bitten.
Der Vertrag von San Stefano sollte die Nationalstaaten
Bulgarien, Rumänien, Serbien und Montenegro schaf-
fen, an Russland musste man die Provinz Kars abtreten.
Zur Schaffung einer neuen Friedensordnung in Südost-
europa initiierte Bismarck den Berliner Kongress, in Zuge
dessen der russische Zugriff auf das Osmanische Reich
zugunsten eines Einflusses aller europäischen Mächte
geschwächt wurde – insbesondere finanziell geriet der
Sultan in zunehmende Abhängigkeit; auch der kulturelle
Austausch mit den Europäern wurde intensiviert. Bos-
nien und Herzegowina gehörten fortan formal weiter zum
Osmanischen Reich, waren aber von Österreich-Ungarn
besetzt und verwaltet. Bulgarien war als eigenständiger
Staat dem Reich tributpflichtig. Diese Ereignisse mar-
kierten das Ende der umfassenden inneren Reform des
Reichs. Abdülhamid II. entwickelte sich zum Despoten,
löste das Parlament auf und berief kein neues ein. Dessen
Wiedereinsetzung wurde 1908 von der oppositionellen
Bewegung der „Jungtürken“ erzwungen. Durch die unsi-
chere innenpolitische Lage spitzte sich die Lage auf dem
Balkan weiter zu – Österreich-Ungarn annektierte Bos-


















