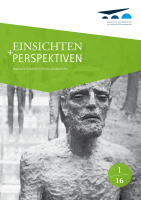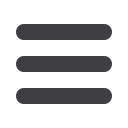
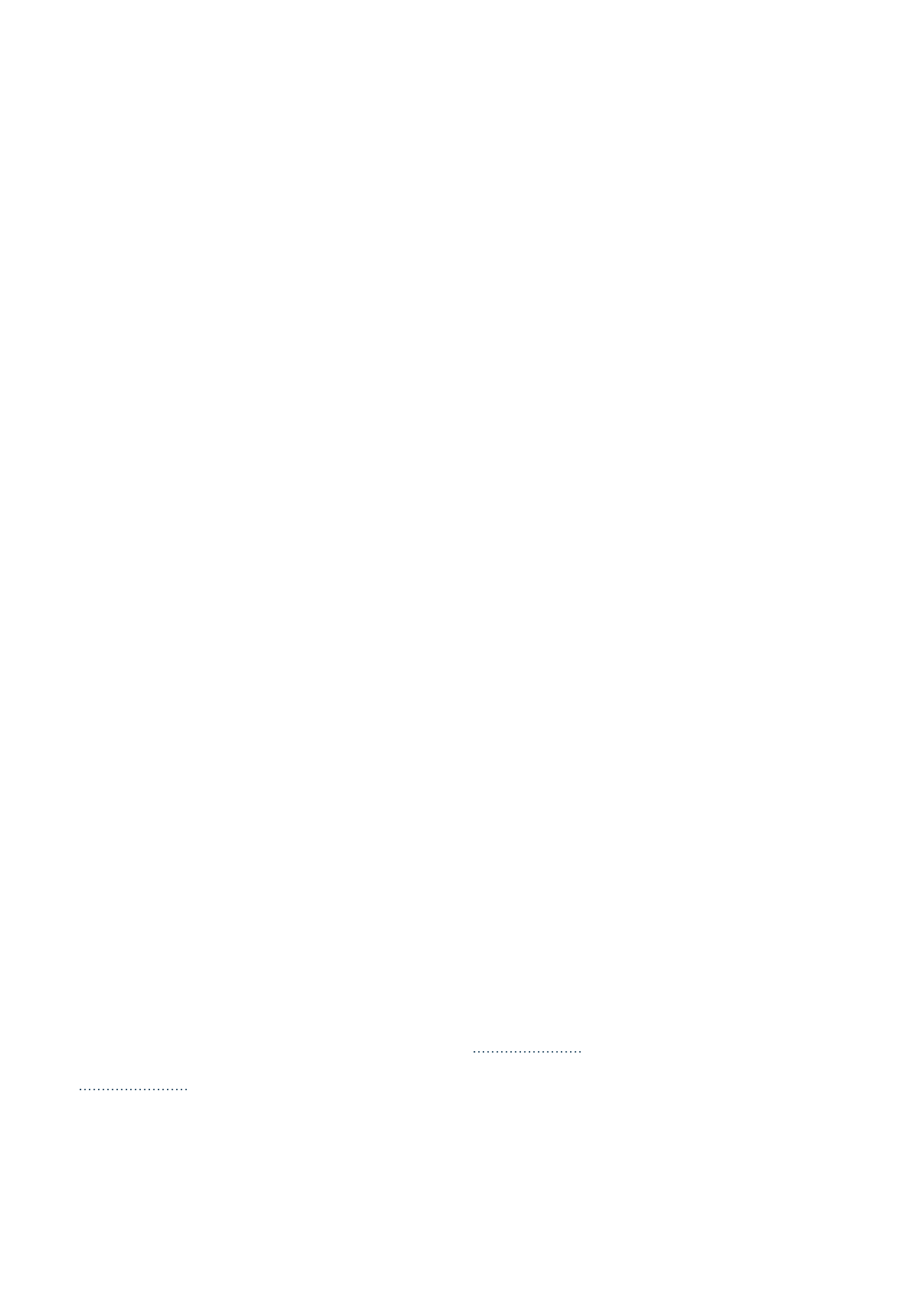
45
Europäische Erinnerungspolitik
Einsichten und Perspektiven 1 | 16
Die Frage nach einer „europäischen Identität“ stellt sich
heute angesichts der multiplen Krisen, denen sich der
Kontinent und vor allem die Europäische Union (EU)
gegenübersehen, in besonderer Dringlichkeit. Ein poten-
tiell wirkungsmächtiges Element politischer Identitäts-
stiftung ist ein gemeinsames „historisches Gedächtnis“,
worunter eine – wie auch immer im Einzelnen geartete –
Form der kollektiven Erinnerung an die Vergangenheit
verstanden werden kann.
2
Indem es dazu beiträgt, die
Vergangenheit festzuhalten, zu ordnen und „verstehbar“
zu machen, dient historisches Gedächtnis der Sinnstiftung
und Gemeinschaftsbildung, insbesondere im Falle rascher
Wandlungsprozesse in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft
und Kultur.
Zugleich aber erweist sich das Konzept eines „histori-
schen Gedächtnisses“ als diffizil. Zwei Herausforderungen
ergeben sich bereits unmittelbar aus dem Begriff selbst:
erstens die Notwendigkeit eine grundlegend individuelle
Fähigkeit, nämlich das Erinnern, zu kollektivieren; zwei-
tens die Überbrückung der Kluft zwischen Geschichte als
Wissenschaft, die sich darauf beruft, auf dem Prinzip der
Objektivität und der Verarbeitung von Fakten zu beruhen,
und dem Erinnern als von Natur aus subjektivem Vor-
gang.
3
Jeder Form von „historischem Gedächtnis“ wohnt
deshalb auch immer eine subjektive Komponente inne,
da die Wahl der Art und Weise, wie man sich der Ver-
gangenheit erinnert, notwendigerweise mit Werturteilen
einhergeht. Dementsprechend ergibt sich eine dezidiert
funktionale Rolle von historischem Gedächtnis, auch und
insbesondere im politischen Kontext.
Die Thematisierung von Geschichte und die Erinne-
rung daran ist ein weit verbreitetes Phänomen der Politik,
und in gewisser Weise unabdingbar für jedwedes politi-
sches System, zumal die Verortung der Gegenwart nicht
zuletzt durch Bezug auf die Vergangenheit erfolgt. Ein
immanentes Risiko besteht indes darin, dass Erinnerung
zum Spielball ideologischer Auseinandersetzung, gegebe-
nenfalls auch zum Instrument einer absichtlichen Miss-
deutung oder Fälschung von Geschichte, gemacht wird.
Umso mehr gilt dies, als Geschichtspolitik ihrem Wesen
nach immer auch mehr oder minder explizit auf Legiti-
mierung – oder umgekehrt Infragestellung – eines Status
2 Sofern nicht anders spezifiziert, werden im Rahmen dieses Aufsatzes „Ge-
dächtnis“ und „Erinnerung“ weitgehend synonym verwendet.
3 Pierre Nora hat diese Kluft einmal wie folgt charakterisiert: „Gedächtnis
trennt, Geschichte eint.“ Pierre Nora: „Nachwort“, in: Deutsche Erinne-
rungsorte. Band III, hg. von Etienne Francois und Hagen Schulze, Mün-
chen 2001, S. 681–686, Zitat S. 686.
Quo ausgerichtet ist: „Wer die Vergangenheit beherrscht,
beherrscht die Zukunft. Wer die Gegenwart beherrscht,
beherrscht die Vergangenheit.“
4
Dieses Diktum aus George Orwells „1984“ bringt das
vielfach historisch genutzte Potential einer Politisierung
und Instrumentalisierung von Geschichte treffend auf den
Punkt, und es verweist zugleich auf die große Verantwor-
tung der Herrschenden nicht nur für die Gestaltung von
Gegenwart und Zukunft, sondern auch den gewissenhaf-
ten Umgang mit der Vergangenheit.
Dies gilt ebenfalls für die europäische politische Ebene,
auf der sich kollektives historisches Erinnern besonderen
Rahmenbedingungen und Herausforderungen gegen-
übersieht. Diese sollen im Folgenden in knapper Form
thematisiert werden, indem
1) zunächst ein Abriss der besonderen Herausforderun-
gen bei der Schaffung eines gesamteuropäischen histo-
rischen Gedächtnisses und eine Darstellung aktueller
politischer Initiativen der Europäischen Union erfolgt;
2) danach bestehende Dilemmata europäischer Politik in
diesem Feld Thematisierung finden;
3) schließlich darauf aufbauend der Versuch unternom-
men wird, Entwicklungsperspektiven zukünftiger euro-
päischer Erinnerungspolitik zu skizzieren.
5
Europäisches historisches Erinnern:
Herausforderungen und politische Initiativen
„Ist ein europäisches kollektives Gedächtnis möglich?“ lau-
tete der Titel eines kurzen Zeitschriftenartikels aus dem
Jahr 1993,
6
und diese damals gestellte Frage erscheint heute
angesichts der allenthalben auszumachenden Desintegra-
tions- und Renationalisierungstendenzen innerhalb der
Europäischen Union aktueller denn je. Debatten über kol-
lektive Formen des Erinnerns an die Vergangenheit sind im
aktuellen wissenschaftlichen, öffentlichen und politischen
Diskurs weit verbreitet. Zugleich stellt sich auf dem europä-
ischen Kontinent mit seiner vielfältigen und in mancherlei
Hinsicht problematischen Geschichte ein gemeinsames his-
torisches Gedächtnis als besonders komplex dar – einerseits
angesichts des schieren Pluralismus bestehender historisch-
kultureller Erfahrungen, die auf europäischer Ebene zusam-
4 George Orwell: 1984, Frankfurt/Main 1982, S. 34.
5 Die nachstehenden Darlegungen folgen im Wesentlichen den – dort etwas
detaillierteren – Ausführungen in Markus J. Prutsch: Europäisches Histo-
risches Gedächtnis: Politik, Herausforderungen und Perspektiven, Brüssel
2
2015.
6 Gérard Namer: „Une mémoire collective européenne est-elle possible?“,
in: Schweizerische Zeitschrift für Soziologie/Revue suisse de sociologie/
Swiss Journal of Sociology 19 (1993), S. 25–32.