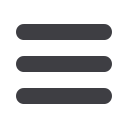
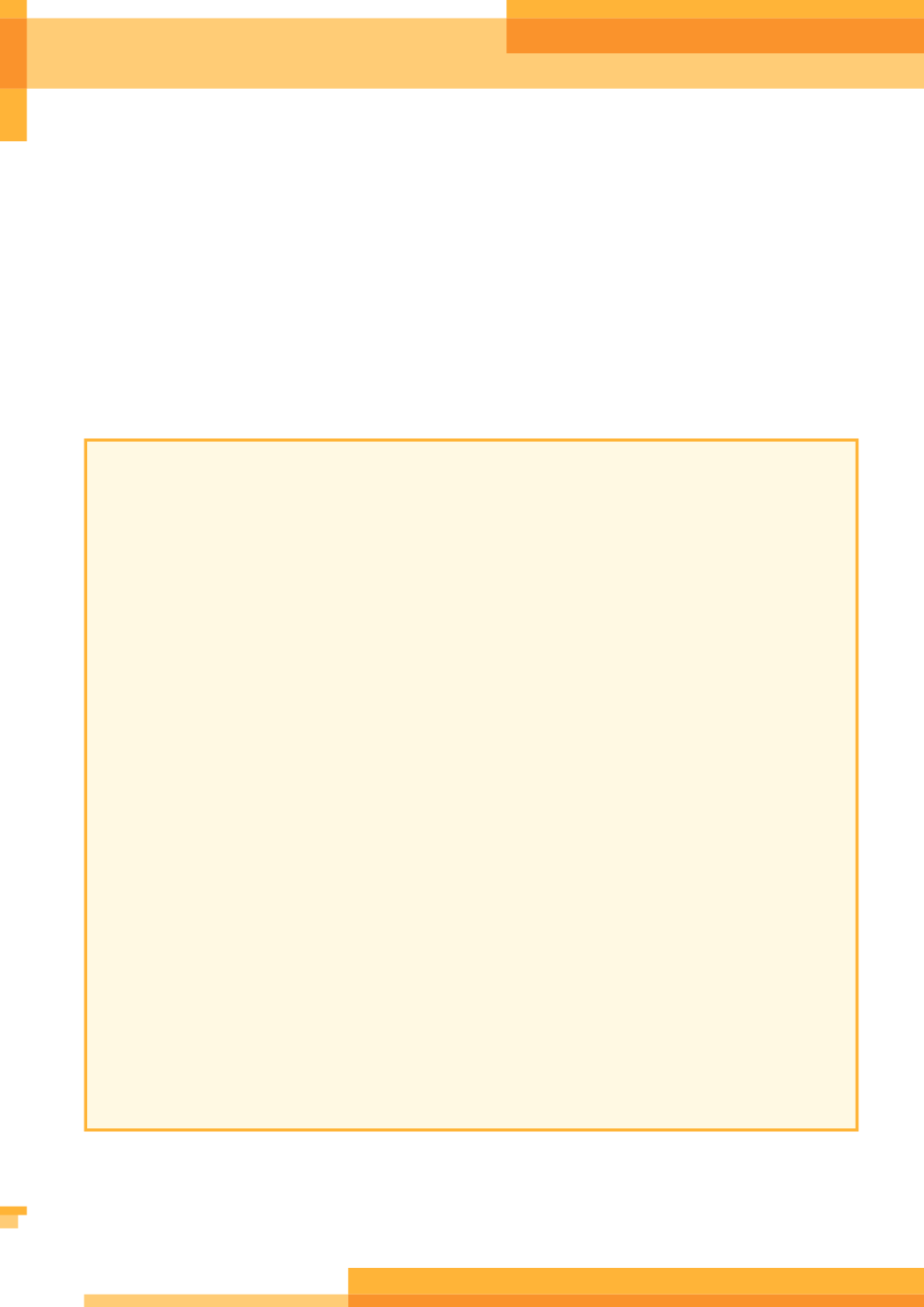
66
Seitdem hat sich einiges geändert: Wenn ihr zu Ordnungs- oder Reinigungsdiensten aufgefordert wer-
det, empfindet ihr das wahrscheinlich nicht mehr als besonderes Entgegenkommen, auch wenn euch
der Lehrer damit zeigt, dass er euch zutraut, Verantwortung zu übernehmen.
Die heutige Ausprägung der an unseren Schulen selbstverständlichen SMV trägt viel stärker das Ziel
der Mitbestimmung in sich. In den u. a. von Paul Geheeb (1870–1961) gegründeten Landerziehungs-
heimen gab es erstmals solche Mitbestimmungsmöglichkeiten, die über reine Ordnungsaufgaben weit
hinausreichten. Es wurden völlig neue Formen der Schülerbeteiligung an Unterricht und Schulleben
erprobt. Außerdem waren das Musische, die Leibeserziehung und das Gemeinschaftsleben der Jugend
nun weitere, wesentliche Elemente der Erziehung.
Die 1906 gegründete „Freie Schulgemeinde Wickersdorf“ (Thüringen) war ganz besonders vom Geist
der damaligen Wandervogel- und Jugendbewegung geprägt.
Stichwort: „Wie der Bengel sich freut!“ – Die deutsche Jugendbewegung
In den Jahren nach 1900 ereignet sich hierzulande Merkwürdiges: Gruppen von Schülern, mit Ruck-
säcken und Kochtöpfen beladen, durchstreifen Wälder und Felder, singen Volks- und Fahrtenlieder
und lagern des nachts draußen um das Feuer. Die „Wandervögel“ sind unterwegs und manche
besorgte Mutter zuhause schüttelt verständnislos den Kopf, wo der Bengel es doch so gemütlich
haben könnte – daheim in der guten Stube. Doch Wohlstand und elterliche Obhut haben die aus-
gebüchsten Jungen schon zu reichlich genossen.
Was war geschehen? Ende des 19. und Anfang des 20. Jh. veränderte sich die Gesellschaft Deutsch-
lands in nie gekannter Geschwindigkeit. Die Bevölkerung wuchs rasend, die Städte dehnten sich
aus, zahlreiche technische Neuerungen hielten Einzug in den Alltag und hatten eine nüchterne,
praktische Lebensweise zur Folge. Die Kinder wurden mit dem Ziel erzogen, möglichst schnell, dem
Vorbild der Eltern folgend, das Leben als Erwachsene führen zu können. So waren auch Schulen
häufig bloße Paukschulen mit autoritären Disziplinierungspraktiken. Das Schulleben war gleich-
förmig, schematisiert und arm an echten Erlebnissen.
Die Jugend des damaligen Bürgertums war also wohl behütet und wuchs meist ohne materielle
Ängste auf. Sie empfand ihr Leben jedoch als billigen Abklatsch der Erwachsenenwelt mit ihren
starren Konventionen und ständischen Vorurteilen – unnatürlich und unecht, von der Natur entfrem-
det und ganz und gar unjugendlich.
In diesem Umfeld unternahmen Berliner Schüler zusammen mit einem Lehrer zahlreiche aben-
teuerliche Wochenendfahrten und ferienlange Wanderungen. Fortschrittliche Lehrer unterstützten
sie dabei, sodass sie im Jahr 1901 einen Verein gründen konnten, den sie „Wandervogel-Ausschuss
für Schülerfahrten“ nannten. Von der Hauptstadt breitete sich die Idee rasch über ganz Deutschland
aus. In vielen Städten entstanden neue Gruppen. Aus der Berliner Wandervogelgruppe war die
deutsche Jugendbewegung geworden.
Die Wandervogelzeit bezeichnet die erste Phase der deutschen Jugendbewegung von 1896 bis
zum Ersten Weltkrieg. Danach entwickelten sich sehr viele verschiedenartige Gruppen, die nun
auch nach weltanschaulichen, gesellschaftlichen und religiösen Idealen strebten. Sie betonten in
starkem Maße das Erlebnis des Bundes und werden daher unter dem Begriff „Bündische Jugend“
zusammengefasst.



















