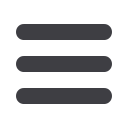

19
Von der Perestroika zur Katastroika, Teil 2
Einsichten und Perspektiven 2 | 16
Kreml bei der Lösung der nationalen Frage als eigentlicher
Hauptakteur frei handeln könnte und bei seiner Reform-
politik auf die Anliegen der Sowjetrepubliken keine grö-
ßere Rücksicht nehmen. Als Estland im November 1988
als erste Sowjetrepublik seine Souveränität erklärte und
den Vorrang der Republiks- vor den Unionsgesetzen ver-
kündete, reagierte Gorbatschow darum barsch und unge-
halten. Er sprach den Verantwortlichen in Estland jegliches
Verantwortungsgefühl ab und bezeichnete sie als nationa-
listische und asoziale Heckenschützen, die „an der Umge-
staltung schmarotzen“.
71
Mit dieser brüsken Ablehnung stieß Gorbatschow die
moderaten politischen Kräfte in den Sowjetrepubliken vor
den Kopf und versperrte sich damit den Weg, gemeinsam
mit ihnen das Verhältnis zwischen den Sowjetrepubliken
und dem Moskauer Unionszentrum durch den Aufbau
realföderativer oder sogar konföderativer Strukturen neu
zu regeln. Das Vertrauen in die nationalitätenpolitische
Reformkompetenz des Moskauer Zentrums sank weiter,
als bewaffnete Verbände des Innenministeriums im April
1989 eine friedliche Demonstration für die Unabhängig-
keit Georgiens in Tiflis gewaltsam auflösten und dabei 20
Menschen töteten. Obwohl Gorbatschow zur Zeit der
Ausschreitungen zu politischen Gesprächen in London
gewesen war, hatte er nun Blut an den Händen.
72
Seine Popularität in den nichtrussischen Peripherien litt
ferner unter dem miserablen Katastrophenmanagement,
nachdem im Dezember 1988 ein schweres Erdbeben
große Landstriche Armeniens verwüstet hatte. Durch lan-
desweite Solidaritätsaktionen wollte Gorbatschow noch
einmal den Zusammenhalt der Union betonen. Doch
die mangelhaft koordinierten Hilfsaktionen demonstrier-
ten nur die vielen Organisationsdefizite des sowjetischen
Parteistaats und die politische Ohnmacht des Moskauer
Zentrums.
73
Dadurch gewannen die Desintegrationsprozesse weiter
an Dynamik; die „Souveränitätsparade“ schritt voran. Bis
Mitte 1990 waren fast alle Sowjetrepubliken dem Beispiel
Estland gefolgt und hatten die Moskauer Verfügungs- und
Entscheidungsrechte massiv eingeschränkt. Es kam zu
einem rasanten Wandel der politischen Landschaften in
71 Gorbatschow, Glasnost (wie Anm. 2), S. 75–81, Zitat S. 76. Die ethnische
Souveränitätsdeklaration findet sich in deutscher Übersetzung in Simon
(wie Anm. 10), S. 275 f.
72 Zu den Ereignissen in Tiflis vgl. die neuen interessanten Dokumente in
Karner (wie Anm. 70), S. 320–332; Brown (wie Anm. 25), S. 434–437;
Alexander Rondeli: Georgien und der Zerfall der UdSSR, in: Malek/Schor-
Tschudnowskaja (wie Anm. 49), S. 365–379.
73 Altrichter (wie Anm. 38), S. 54–59.
den nichtrussischen Peripherien, zumal es oftmals die dor-
tigen Partei- und Staatsbehörden waren, die immer souve-
ränitätsbewusster auftraten. Die nationalen Sammelbewe-
gungen integrierten alles, was sich an Unmut, Protest und
Verbitterung gegen die Sowjetordnung angestaut hatte,
und wurden damit zur Speerspitze der antisowjetischen
Mobilisierung, die rasant an gesellschaftlicher Tiefe und
politischer Dynamik gewann.
Erste Abspaltungen und letzte Rettungsversuche,
1990 und 1991
Als der Kreml im Verlauf des Jahres 1989 den Ostblock als
sozialistisches Zwangsbündnis auflöste und seinen Bünd-
nispartner zubilligte, fortan ihren eigenen Weg zu gehen,
hatte das auch massive Folgen für die innersowjetischen
Entwicklungen. Bei der nationalen Interessenbehauptung
in den baltischen Sowjetrepubliken sowie in Moldawien,
Armenien und Georgien ging es nun nicht mehr nur um
den Zugewinn an Autonomie- und Selbstbestimmungs-
rechten. Die separatistischen Kräfte gewannen die Über-
hand. Sie drängten auf die Abspaltung vom sowjetischen
Unionsstaat, um die vollständige staatliche Unabhängigkeit
zu erlangen. Aus den im Frühjahr 1990 in den Sowjet-
Staats- und Parteichef Gorbatschow besucht mit seiner Frau Raissa die
Stadt Leninakan (Gjumri), um sich ein Bild der schweren Erdbebenfolgen zu
machen, Dezember 1988.
Foto: ullstein bild/Sputnik


















