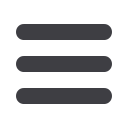
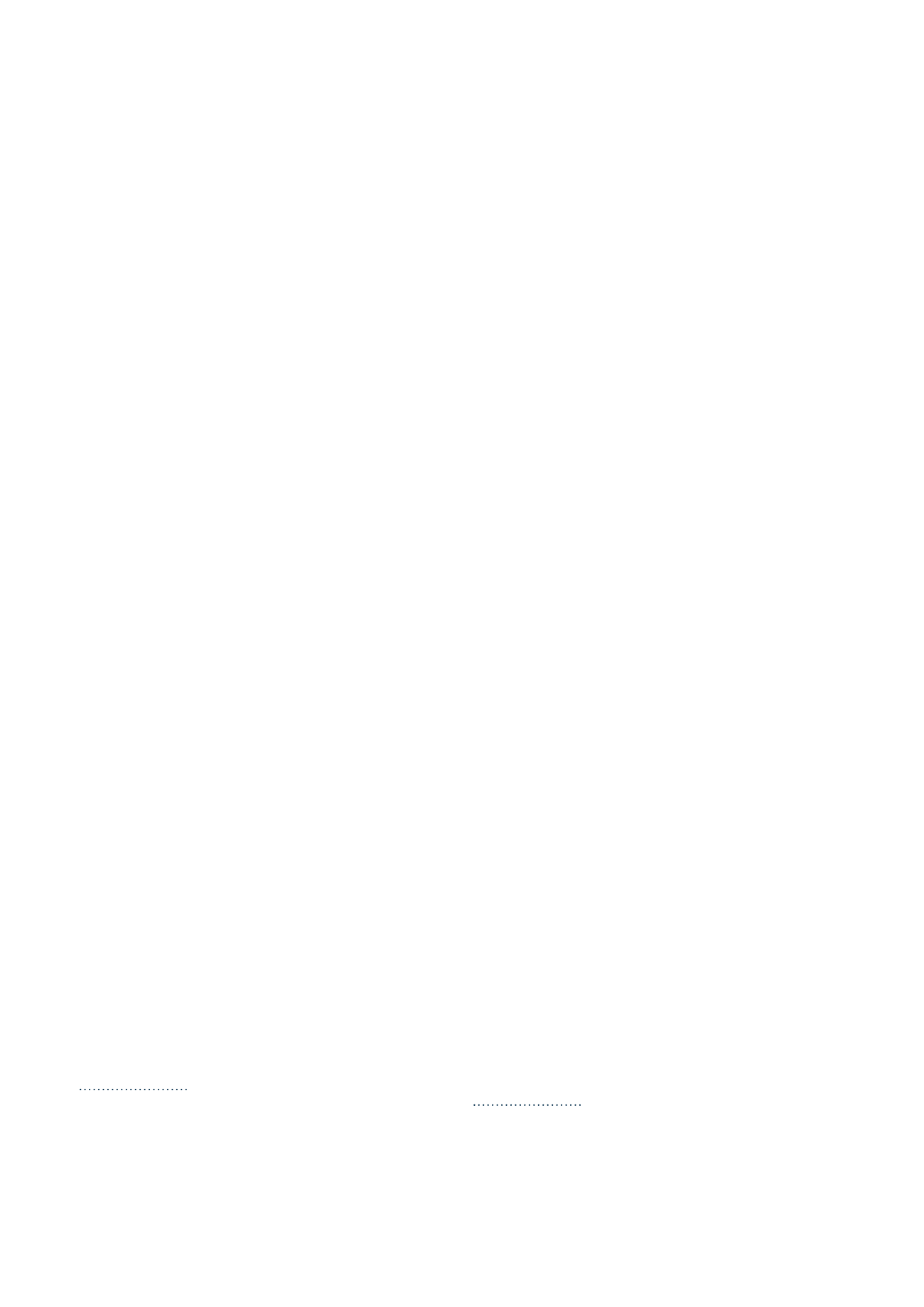
38
Toni Pfülf (1877–1933)
Einsichten und Perspektiven 2 | 17
stellung von Mann und Frau in der Ehe, die Reformierung
des Ehescheidungsrechts, die Gleichstellung außerehe
licher und ehelicher Kinder, staatliches Kindergeld sowie
die Neuordnung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes.
Und sie beschwört die Notwendigkeit eines tiefgreifenden
Wandels in der politischen Kultur.
Im Parlament ist Toni Pfülf zudem in der Jugend- und
Bildungspolitik engagiert und argumentiert gegen eine
frühzeitige Auslese von Schulkindern nach vier Grund-
schuljahren. Persönlich ist sie der Ansicht, alle Kinder
sollten acht Jahre gemeinsam zur Schule gehen, vertritt
im Parlament aber die Linie ihrer Fraktion und plädiert
für eine zumindest sechsjährige gemeinsame Schulzeit
aller Kinder, „gegenseitig nehmend und gebend, was sie
zu geben und zu nehmen haben“. Volksschule und höhere
Schule sollten nicht nebeneinanderlaufen, sondern „zu
einem organischen Ganzen zusammenwachsen“.
17
Eines ihrer zentralen Anliegen ist die Gleichberechti-
gung von Beamtinnen, etwa durch die Abschaffung des
Heiratsverbotes (sogenanntes Lehrerinnen-Zölibat). Der
Zölibatsklausel zufolge mussten Frauen bei ihrer Heirat
aus dem Staatsdienst ausscheiden und verloren auch ihren
Anspruch auf Ruhegehalt. Heirateten sie nach ihrer Pen-
sionierung, konnte der Staat das Ruhegehalt ganz oder
teilweise zurückziehen. Als Folge dieser Praxis wurden
ausschließlich ledige oder kinderlose Witwen als Beamtin-
nen angestellt. In ihrer Parlamentsrede in der Nationalver-
sammlung zu einem entsprechenden Antrag erwähnt sie
als „rühmliche Ausnahme“ das bayerische Beamtengesetz
von 1910, „das der Beamtin theoretisch den Verbleib im
Amt gewährleistet, auch wenn sie in die Ehe tritt“.
18
Die Verwaltungswissenschaftlerin Eleonora Kohler-Geh-
rig erläutert die wechselvolle Geschichte der Zölibatsklausel:
„1921 verkündete das Reichsgericht die Verfassungswid-
rigkeit der Zölibatsklausel aufgrund Art. 128 Abs. 2 der
Weimarer Verfassung. Die Personalabbauverordnung von
1923 führte das Berufsverbot für verheiratete Beamtinnen
faktisch wieder ein. Das Dienstverhältnis von verheirateten
weiblichen Beamtinnen, selbst bei Beamtinnen auf Lebens-
zeit, wurde jederzeit kündbar gemacht. Die Zölibatsklausel
wurde 1932 wieder eingeführt und imBundespersonalgesetz
von 1950 weitergeführt. Erst Art. 3 GG und Art. 117 GG
17 Reichstagsprotokolle 1919/20, 151. Sitzung der Nationalversammlung vom
8. März 1920 http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt2_wv_bsb000000 16_00426.html [Stand: 01.05.2017].18 Reichstagsprotokolle 1919/20, 59. Sitzung der Nationalversammlung vom
17. Juli 1919. http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt2_wv_bsb000000 12_00184.html [Stand: 01.05.2017].brachten 1953 den verfassungsmäßigen Gleichheitsgrund-
satz für Beamtinnen wieder zur Geltung. Die Zölibatsklau-
sel hatte zwei Funktionen. Sie diente dazu, den Beamtinnen
ein gleichwertiges Qualifikationsniveau gegenüber ihren
Kollegen abzusprechen, da sie nur befristet als Arbeitskräfte
zur Verfügung standen. Damit erhielt die Verwaltung eine
flexible, junge und leistungsfähige Belegschaft und konnte
die sozialen Folgekosten möglichst niedrig halten.“
19
Entschieden vertritt Toni Pfülf die Überzeugung, der
Staat als Arbeitgeber habe nicht das Recht, sich in die Privat-
angelegenheiten seiner Arbeitnehmer wie etwa den Perso-
nenstand einzumischen. Die gelernte Lehrerin bleibt selbst
zeitlebens unverheiratet und kinderlos. Doch vollzieht die
Abgeordnete der Weimarer Nationalversammlung daheim
in München einen Schritt, der ihr nachhaltigen Ärger mit
der staatlichen Obrigkeit einbringen sollte: Im Herbst des
Jahres 1919 tritt sie aus der katholischen Kirche aus.
Ein Kirchenaustritt und seine Folgen:
„Eine Beschäftigung der Pfülf ist zu unterlassen“
Nach krankheitsbedingtem vorübergehendem Ruhestand
kehrt Toni Pfülf im Frühjahr 1920 in den Schuldienst
zurück – zumindest offiziell. Laut Personalakten ist sie
an der Haimhauserschule beziehungsweise an der Schule
an der Simmernstraße in München Schwabing angestellt.
Ende September fordert sie von der Schulbehörde eine
Hilfslehrerin an, „da mich dringende parlamentarische
Pflichten sehr häufig von München abrufen“
20
Wenige Wochen zuvor, am 9. September 1920, war
sie von Stadtschulinspektor Reichel ins Rathaus gebe-
ten worden. Was sie nicht ahnte: Der Beamte hatte von
der Regierung von Oberbayern den Auftrag erhalten, ihr
das Geständnis ihres Kirchenaustritts zu entlocken. Man
gedenkt sie wegen dieses Schritts zu sanktionieren, gemäß
dem Grundsatz, dass an bayerischen Schule nur Lehrer
mit christlichem Glaubensbekenntnis zum Einsatz kom-
men könnten. Zunächst hatte man versucht, hinter ihrem
Rücken von den Münchner Standesämtern einen schrift-
lichen Beweis ihres Kirchenaustritts zu erhalten. Nach-
dem das erfolglos geblieben war, soll die Betroffene nun
also selbst zum Reden gebracht werden. Zu Beginn des
Gesprächs sichert der Stadtschulinspektor Toni Pfülf Ver-
traulichkeit zu; doch nachdem sie ihm den Kirchenaus-
19 Eleonora Kohler-Gehrig: Die Geschichte der Frauen im Recht, August 2007
(PDF). www.verwaltungmodern.de/wp-content/uploads/2011/11/skfrauen geschichte_1.pdf, S. 23 [Stand: 01.05.2017].20 Schreiben von Toni Pfülf an die Schulbehörde München vom 27. Septem-
ber 1920, in: Personalact (wie Anm. 5).


















