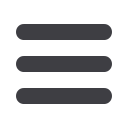
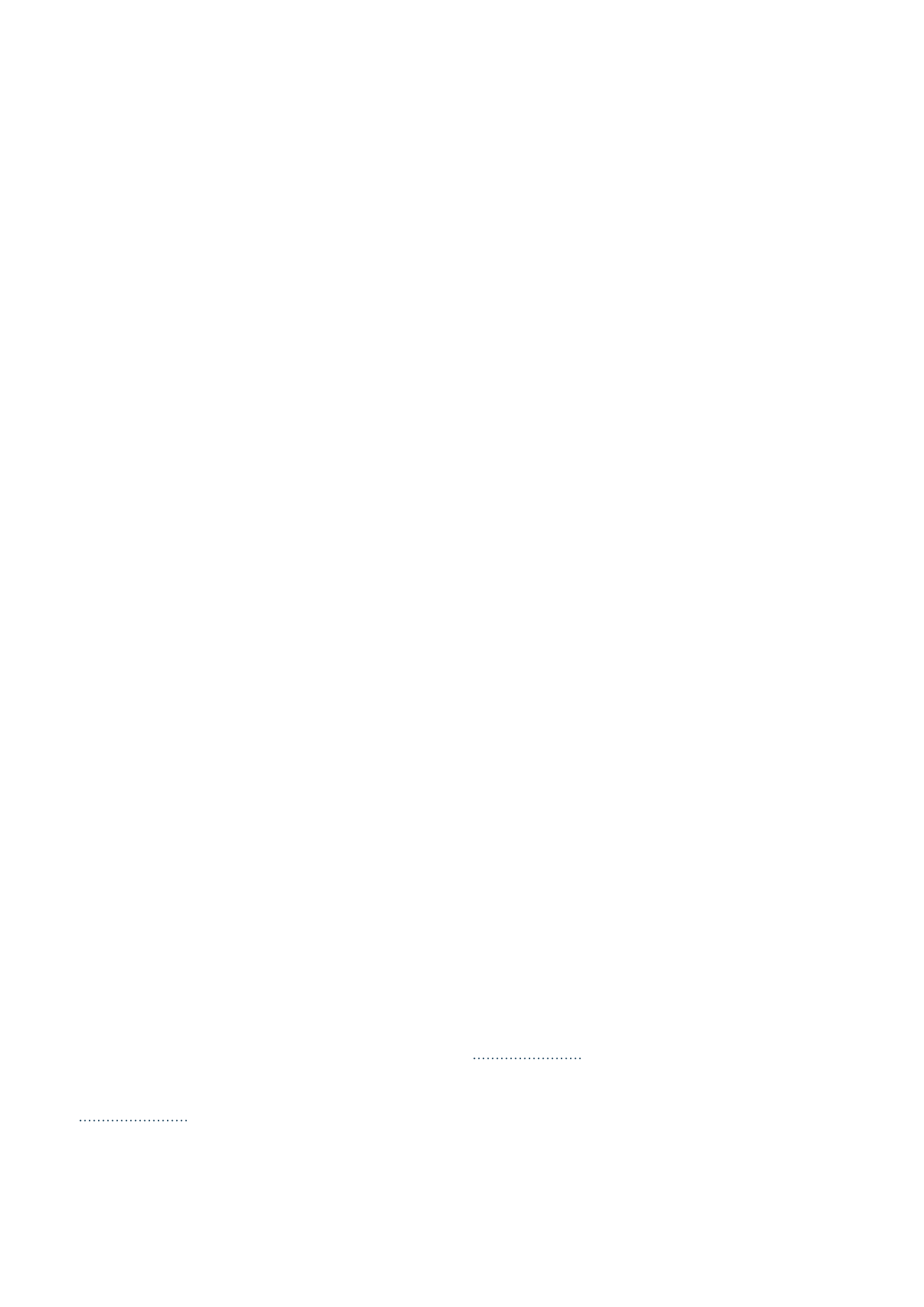
33
Toni Pfülf (1877–1933)
Einsichten und Perspektiven 2 | 17
„Heute hat es eher den Anschein, als sei das deutsche Volk eine seichte,
willenlose Herde von Mitläufern, denen das Mark aus dem Innersten gesogen
und die nun ihres Kerns beraubt, bereit sind, sich in den Untergang hetzen zu
lassen. Es scheint so – aber es ist nicht so; vielmehr hat man in langsamer,
trügerischer, systematischer Vergewaltigung jeden einzelnen in ein geistiges
Gefängnis gesteckt, und erst als er darin gefesselt lag, wurde er sich des
Verhängnisses bewußt. Wenige nur erkannten das drohende Verderben, und
der Lohn für ihr heroisches Mahnen war der Tod.“
1
So heißt es im ersten
Flugblatt der Weißen Rose vom 27. Juni 1942. Ob Hans Scholl und Alexander
Schmorell bei dieser Formulierung auch Toni Pfülf im Sinn hatten? Jedenfalls
passt der letzte Satz auf die weitsichtige, mutige Frau, Lehrerin und Reichstags-
Abgeordnete, die ihre Stimme gegen die Nationalsozialisten erhob und 1933 in
Konsequenz ihres Widerstands und aus Verzweiflung über ihre Parteigenossen
freiwillig aus dem Leben schied.
„Das ist ja ein Mann“
Die Großmutter hatte dem kleinen Emil viel von Toni
Pfülf erzählt – von jener wortgewandten, couragierten
Frau, die im Wahlkampf zur Reichstagswahl 1912 in
München rote Flugblätter verteilte. Der Achtjährige durfte
den Großvater zu einer Wahlkampfversammlung in die
Gaststätte Birk in der Baaderstraße begleiten; weil Kin-
dern der Zutritt verboten war, hockte er unter dem Tisch
und verfolgte von dort das Geschehen. „Ein Teilnehmer
meinte, man müsse die Frauen, die nicht wahlberechtigt
waren, ansprechen. Sie sollen am Wahltag ihre Männer
anhalten die Liste der Sozialdemokraten zu wählen, weil
nur die Sozialdemokraten für die Gleichberechtigung und
das Frauenwahlrecht eintraten“, erinnert sich Emil. Der
Großvater erklärte ihm, wer da so gesprochen hatte: Das
war Toni Pfülf. „Ich sagte, das ist ja ein Mann, der hat
ja eine Hose und eine Joppe an sowie auf dem Kopf ein
Lukikappel.“ Toni Pfülf habe sich „aus Sicherheitsgrün-
den“ als Mann verkleidet.
So schildert es der 80-jährige Emil Holzapfel in seinen
Lebenserinnerungen,
2
und von hier aus hat die Szene Ein-
gang in viele Darstellungen zu Toni Pfülf gefunden. Ob es
1
S. http://www.gdw-berlin.de/fileadmin/bilder/publ/begleitmaterialien/Fak similes_PDFs_deutsch/FS_15.1_DE_2.Aufl-RZ-web.pdf [Stand: 26.06.2017].2 Oskar Krahmer, Gerdi Müller (Hg.): Der rote Emil. Ein bayerischer Sozialist
erzählt, München 1983, S. 24 f.
sich wirklich so zugetragen hat und ob die zeitliche Ein-
ordnung stimmt, bleibt, wie auch manch anderes in der
Biographie dieser engagierten Frau, eine offene Frage. Mit
Erlass des Reichsvereinsgesetzes von 1908 konnten Frauen
offiziell Mitglied einer Partei werden. Nach Antritt einer
Lehrerinnen-Stelle in München-Milbertshofen trat die
30-Jährige in jenem Jahr der Ortsgruppe bei und wurde
Mitglied im Ortsvorstand.
3
Zur Sozialdemokratie soll sie
jedoch bereits 1902 gelangt sein, „angesichts des Kinder
elends, das sie als Junglehrerin in den zum Teil proletari-
schen Familien ihrer Schüler erlebte.“
4
Herkunft
Ihre Mutter Justine geborene Stroehlein entstammte einer
Aschaffenburger Juristenfamilie, Vater Emil Pfülf, geboren
in Speyer, war Oberst und im lothringischen Metz statio-
niert. Hier kommt Antonie am 14. Dezember 1877 zur
Welt. Die Eltern rufen sie „Toni“. Sie und ihre Schwester
Emma genießen eine standesgemäße Erziehung mit Gou-
3 (Michael Schröder:) Toni Pfülf 1877–1933. Bayerisches Seminar für Politik e.V.
1984, S.3.
4 Antje Dertinger: „Pfülf, Toni (Antonie)“ in: Neue Deutsche Biographie
20 (2001), S. 364 [Online-Version]: https://www.deutsche-biographie. de/gnd118740903.html#ndbcontent [Stand 01.05.2017]. Die folgendenAngaben zum familiären Hintergrund nach Antje Dertinger: Dazwischen
liegt nur der Tod – Leben und Sterben der Sozialistin Antonie Pfülf, Berlin/
Bonn 1984, S. 17 f.


















