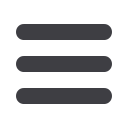
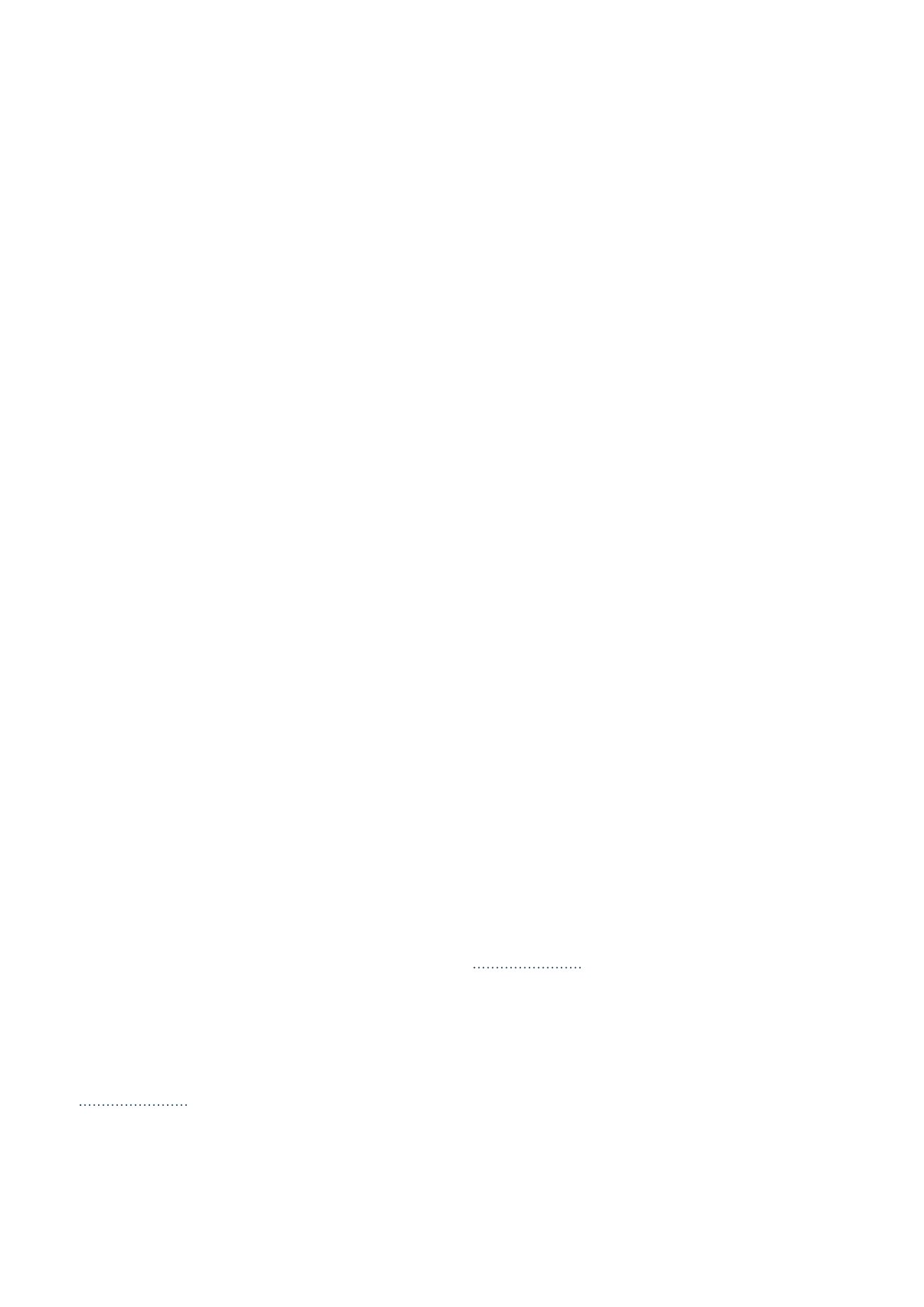
34
Toni Pfülf (1877–1933)
Einsichten und Perspektiven 2 | 17
vernanten und Dienern; doch anders als ihre zwei Jahre
ältere Schwester erscheint Toni von klein auf als unange-
passt, entwickelt anscheinend schon früh Kampfgeist. Mit
19 setzt sie gegen den Willen der Eltern ihren Wunsch,
Lehrerin zu werden, in die Tat um und macht sich offenbar
eigenständig auf den Weg nach München. Ein Universi-
tätsstudium war Frauen zu dieser Zeit in Bayern (bis 1903)
noch verwehrt; sie besucht also das Lehrerinnenseminar.
Nach dem Examen, das sie glänzend besteht, geht es 1902
zunächst als „Verweserin“ (Vertretungslehrerin) hinaus aufs
Land. Oberammergau, Lechhausen und Peiting sind die
Stationen, bevor sie 1907 eine Anstellung an der Volks
hauptschule in München-Milbertshofen bekommt.
5
In der Zwischenzeit ist auch die Familie Pfülf in Mün-
chen ansässig geworden, wo der Vater als Vorstand der
Armeebibliothek tätig ist. 1901 bezieht man eine Woh-
nung in der Akademiestraße, in der auch Toni zeitweise
gemeldet ist. 1907 erfolgt ein Umzug in die Königin-
straße; die Wohnung der Eltern darf Toni jedoch nicht
mehr betreten, als sie erfahren, dass ihre Tochter sich
den Sozialdemokraten angeschlossen hat. Sie kämpft für
Chancengleichheit und Verbesserungen im Bildungswe-
sen. Doch schon bald nach ihrer offiziellen Ernennung
zur Lehrerin im September 1910 macht ihr eine Tuber-
kuloseerkrankung, die sie sich als Hilfslehrerin auf dem
Land zugezogen hatte, so schwer zu schaffen, dass sie in
den nächsten zehn Jahren aus gesundheitlichen Gründen
immer wieder in zeitweiligen Ruhestand versetzt wird und
nicht mehr selbst unterrichtet.
„Keine Revolutionierung der Geister, wenn Sie die
Jugend nicht haben!“
Am Vorabend des Ersten Weltkriegs, im Juli 1914, ruft
die SPD zum Massenprotest gegen die Bewilligung von
Kriegskrediten auf; auch die überzeugte Kriegsgegnerin
Toni Pfülf vertritt diese Position. Doch während sie in den
innerparteilichen Diskussionen für eine Stimmenthaltung
der SPD in dieser Frage plädiert,
6
macht die Reichstags-
Fraktion in Berlin eine 180-Grad-Wende und stimmt den
Krediten zu. Während des Krieges engagiert Toni Pfülf
sich ehrenamtlich als Armen- und Waisenrätin, küm-
mert sich um in Not geratene Familien. Bei Ausbruch der
Revolution im November 1918 wird sie Vorsitzende des
5 Dort war sie von 1907-1910 angestellt, siehe Personalact der Pfülf Anto-
nie (Hauptlehrer) der Regierung von Oberbayern (StA München), Beurtei-
lungsbogen.
6 (Michael Schröder:) Toni Pfülf 1877–1933. Bayerisches Seminar für Politik e.V.
1984, S. 5.
Bundes sozialistischer Frauen, den sie mitgegründet hat.
Hingegen ist sie nicht Mitglied im Landesarbeiterrat, wie
verschiedentlich zu lesen ist. Einziges weibliches Mitglied
dort war vielmehr die Münchnerin Hedwig Kämpfer.
7
Emil Holzapfel erzählt in seinen Erinnerungen aus
den 1980er Jahren, wie Toni Pfülf Ende November 1918
uneingeladen den Mathäser-Festsaal betreten habe, wo
der Arbeiter- und Soldatenrat tagte, dem ausschließlich
Männer angehört hätten. Sitzungsleiter Erich Mühsam
habe sie aufgefordert, die Sitzung zu verlassen. Sie habe
sich energisch gewehrt und gesagt: „Man kann mich nur
mit Gewalt aus dem Sitzungssaal befördern, denn ich
habe hier im Arbeiter- und Soldatenrat die Interessen der
Frauen zu vertreten!“ Die anwesenden Arbeiter- und Sol-
datenräte hätten abgestimmt und mit knapper Mehrheit
beschlossen, Toni Pfülf nicht in das Gremium zuzulas-
sen.
8
Auch so eine Geschichte, bei der offen bleibt, inwieweit
sie den Tatsachen genau entspricht. Das erste Spitzengre-
mium der Arbeiterräte in Bayern war der in der Revoluti-
onsnacht am 7. November 1918 im Mathäserbräu gebil-
dete „Revolutionäre Arbeiterrat“. Ihm gehörten drei Frauen
an: Viktoria Gärtner, Hedwig Kämpfer, Agnes Loser, alle
USPD. Unter den insgesamt 72 Mitgliedern war auch der
Schriftsteller Erich Mühsam, jedoch ohne leitende Funk-
tion. Der Münchner Arbeiterrat bildete sich erst später, am
7. Dezember 1918. Hier saß Hedwig Kämpfer als Schrift-
führerin im Vorstand, auch dies war also kein reines Män-
nergremium.
9
Toni Pfülfs Name findet sich in keinem Mitgliederver-
zeichnis eines Räte-Gremiums. Indes wird sie – zusam-
men mit vier weiteren Frauen – am 8. Dezember 1918
als Delegierte des Münchner Arbeiterrates gewählt
10
und
nimmt in dieser Eigenschaft an der Versammlung des
Zentralarbeiterrates der Revolutionäre am 10. Dezember
teil. Und hier ergreift Pfülf in offenherziger, kämpferi-
7 Georg Köglmeier: Landesarbeiterrat, 1918/19, publiziert am 22.11.2012;
in: Historisches Lexikon Bayerns: https://www.historisches-lexikon-bayerns. de/Lexikon/Landesarbeiterrat, 1918/19 [Stand: 01.05.2017].8 Der rote Emil (wie Anm. 2) S. 110 f.
9 Vgl. Georg Köglmeier: Die Zentralen Rätegremien in Bayern 1918/19.
Legitimation – Organisation – Funktion, München 2001, S. 85-116 (bes.
103) und S. 434–438. Emil Holzapfel war nach eigenen Angaben als Lehr-
ling jüngstes Mitglied im Arbeiter- und Soldatenrat, vgl. Der rote Emil
(wie Anm. 1) S. 37. Ob dies zutrifft und ob es außer Hedwig Kämpfer
noch weitere Frauen gab, lässt sich durch Köglmeiers Untersuchung nicht
überprüfen, da das Gremium über 400 Mitglieder umfasste, die nicht na-
mentlich verzeichnet sind.
10 Köglmeier (wie Anm. 9), S. 122 ( Anm. 245).


















