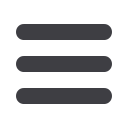
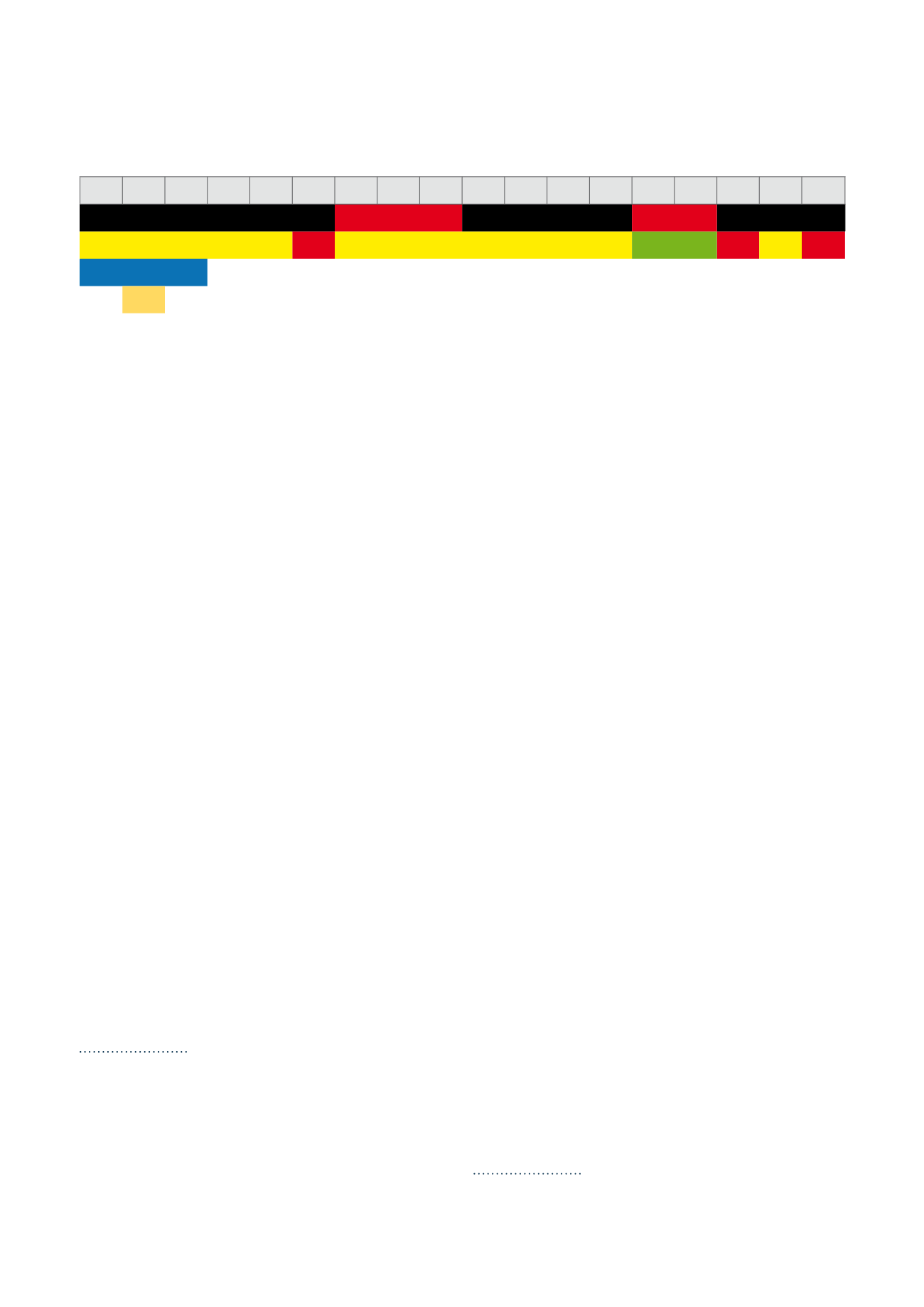
63
Bunte Koalitionsrepublik Deutschland
Einsichten und Perspektiven 2 | 17
Auf Ebene der Länder zeichnet sich bereits länger ein
umfassender Wandel ab: Schon 2006 sondierten etwa in
Baden-Württemberg nach den Landtagswahlen CDU und
Grüne vor den Augen einer überraschten Öffentlichkeit
eine Zusammenarbeit – wenn auch letztlich erfolglos.
12
Zur
ersten Realisierung einer schwarz-grünen Koalition kam es
2008 im Stadtstaat Hamburg unter dem Regierenden Bür-
germeister Ole von Beust (CDU). Ein Jahr später bildete
sich im Saarland unter Führung des Ministerpräsidenten
Peter Müller ein Bündnis aus CDU, FDP und Grünen (die
sog. „Jamaika“-Koalition). Beide neuen Koalitionsvarianten
überstanden allerdings nicht die ganze Legislaturperiode
und gingen im Streit auseinander. In Hamburg knirschte
es in der Zusammenarbeit, nachdem ein Volksbegehren die
schwarz-grüne Schulreform gekippt hatte.
13
Der Rücktritt
des Bürgermeisters von Beust, Architekt und Gesicht des
Experiments, unterminierte den vorher vertrauensvollen
Umgang der Koalitionäre. Nach weiteren Personalwechseln
innerhalb der CDU und erkennbaren Abstimmungs- und
Kommunikationsschwierigkeiten kündigten die Grünen
das Bündnis im November 2010 auf – wobei sicher die zu
der Zeit sehr guten Umfragewerte ihren Teil beitrugen. Im
Saarland regierte die Koalition aus CDU, FDP und Grü-
nen geräuschlos, große inhaltliche Konflikte gab es keine.
14
Das lag unter anderem darin begründet, dass der grüne
Partei- und Fraktionsvorsitzende Hubert Ulrich als Befür-
worter der neuen Koalitionsvariante seinen Landesverband
klar dominierte. Auch hier gab es einen Wechsel im Minis-
12 Vgl. Niko Switek: Bündnis 90/Die Grünen. Koalitionsentscheidungen in
den Ländern, Baden-Baden 2015.
13 Vgl. Katharina Fegebank: Schwarz-Grün in Hamburg. Ein Wagnis, das
vorzeitig beendet wurde, in: Volker Kronenberg/Christoph Weckenbrock
(Hg.): Schwarz-Grün. Die Debatte, Wiesbaden 2011, S. 242–255.
14 Vgl. Adolf Kimmel: Jamaika im Saarland. „Ein neues Kapitel in der Parteien-
geschichte der Bundesrepublik“?, in: Volker Kronenberg/Christoph Wecken-
brock (Hg.): Schwarz-Grün. Die Debatte, Wiesbaden 2011, S. 288–306.
terpräsidentenamt von Peter Müller (CDU) zu Annegret
Kramp-Karrenbauer (CDU), ursächlich für das Ende der
Koalition waren aber ein heftiger Streit und Skandale inner-
halb der mitregierenden FDP. Die neue Ministerpräsiden-
tin beendete daher im Januar 2012 das Experiment und
holte sich stattdessen die SPD in die Regierung.
Schwerer tat sich auf der anderen Seite das linke Lager
mit einer Zusammenarbeit: Die SPD-Spitzenkandidatin
Andrea Ypsilanti scheiterte 2008 in Hessen mit dem ers-
ten Versuch einer rot-grünen, von der Linkspartei tolerier-
ten Landesregierung spektakulär an Widerstand aus der
eigenen Fraktion.
15
Im Wahlkampf hatte sie eine Zusam-
menarbeit mit den Linken kategorisch ausgeschlossen und
erkennbar die Strategie verfolgt, die Partei aus dem Land-
tag zu halten. Gerade in den alten Bundesländern gaben
sich die Landesverbände der Linkspartei häufig radikal und
wenig kompromissbereit. Ihre Hauptkritik galt den Agenda-
2010-Reformen der rot-grünen Bundesregierung unter
Gerhard Schröder (SPD), was häufig mit einer Verklärung
der DDR-Geschichte einherging. Ihr Wählerpotential fällt
im Westen deutlich geringer aus, oft scheiterten sie auch
an der Fünf-Prozent-Hürde. Nachdem SPD und Grüne in
Hessen eine Mehrheit zur Ablösung der Landesregierung
unter Roland Koch (CDU) verfehlten, änderte Ypsilanti
nach einigem Zögern ihren Kurs. Der abrupte Kurswech-
sel sorgte für viel Unmut in der Öffentlichkeit und in der
eigenen Fraktion, aus der ihr letztlich vier Abgeordnete die
Unterstützung untersagten. Hannelore Kraft (SPD) hatte in
ihrem Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen 2010 ihre Leh-
ren aus dem Fall gezogen und äußerte sich weniger strikt
ablehnend. Das erlaubte ihr – diesmal ohne einen öffentli-
chen Aufschrei – die Bildung einer rot-grüne Minderheits-
regierung mit Tolerierung der Linkspartei voranzutreiben.
15 Vgl. Volker Zastrow: Die Vier: eine Intrige, Berlin 2009.
Zusammensetzung der Bundesregierungen nach Bundestagswahlen 1949–2013
’49 ’53 ’57 ’61 ’65 ’69 ’72 ’76 ’80 ’83 ’87 ’90 ’94 ’98 ’02 ’05 ’09 ’13
CDU/CSU
SPD
FDP
B90/Grüne
DP
BHE
Anmerkung: CDU – Christlich-Demokratische Union Deutschlands; CSU – Christlich-Soziale Union in Bayern; SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands;
FDP – Freie demokratische Partei; DP – Deutsche Partei; BHE – Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten; B90/Grüne – Bündnis 90/Die Grünen
Quelle: Eigene Darstellung.


















