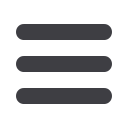
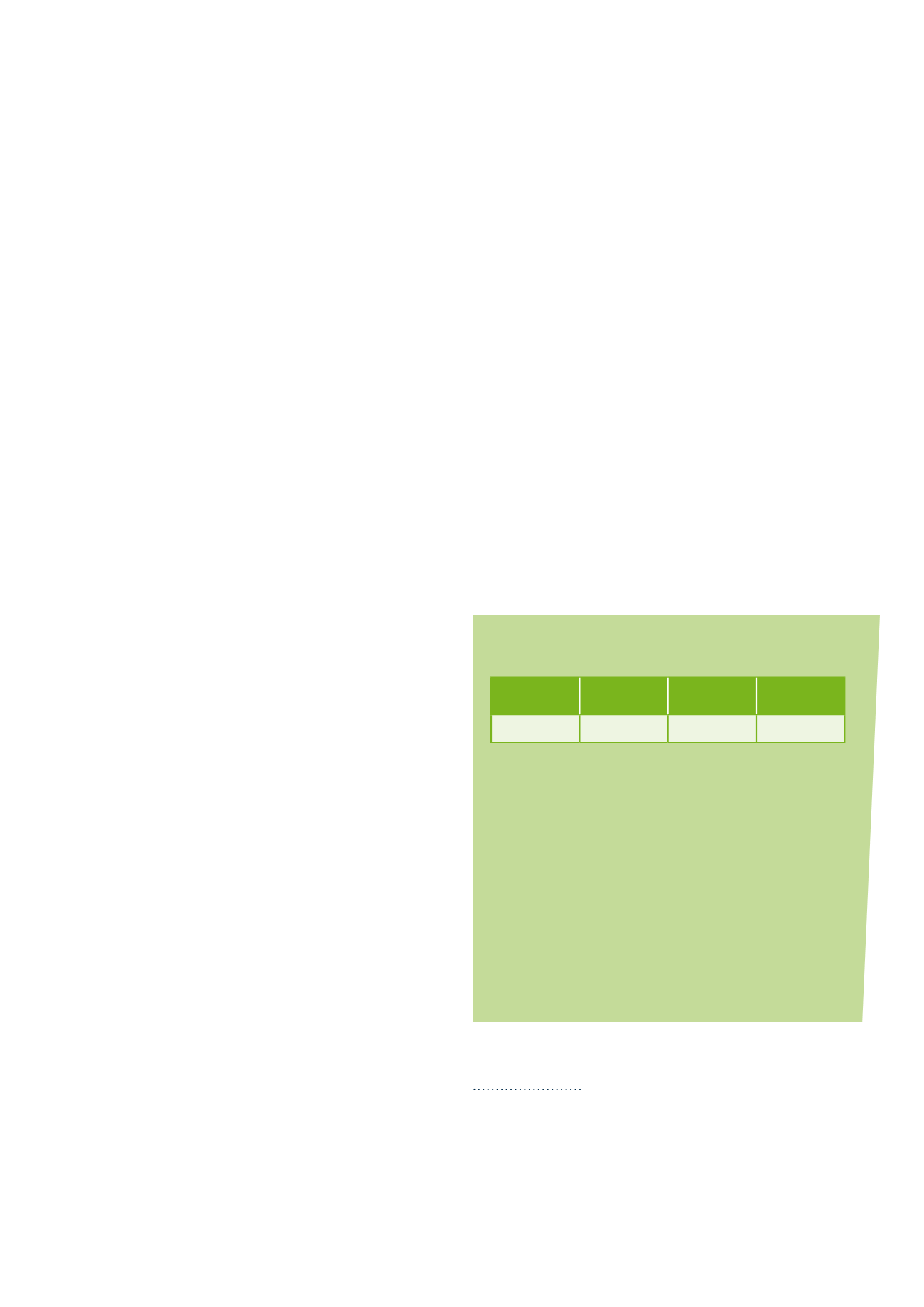
60
Bunte Koalitionsrepublik Deutschland
Einsichten und Perspektiven 2 | 17
dass die Verhandlungsmasse potentieller Koalitionäre die
zu vergebenden Ministerposten sind, vermeidet man über-
große Koalitionen und sucht stattdessen die geringstmög-
liche Zahl von Partnern. Damit steigt die Zahl der Ämter,
die jede der beteiligten Parteien besetzen kann.
Unabhängig von der Zahl der Sitze ist der zweite zen-
trale Faktor die programmatische Nähe oder Distanz der
im Parlament vertretenen Parteien. Eine Koalition muss
sich in den Verhandlungen auf ein einigermaßen stabiles
und stimmiges Regierungsprogramm verständigen, das
die Grundlage für ihr zukünftiges Regierungshandeln
bildet (und das in Form einer Koalitionsvereinbarung
schriftlich fixiert wird). Unbesehen jeder Sitzverteilung
ist beispielsweise in Deutschland aktuell ein Bündnis von
Union und FDP auf der einen mit der Linkspartei auf der
anderen Seite wegen der weit reichenden programmati-
schen Differenzen nicht denkbar. Zugleich zeigt das Bei-
spiel der deutschen Grünen, dass Parteien durchaus wand-
lungsfähig sind. Trat die grüne Partei anfangs als radikale
Fundamentalopposition auf, mäßigte sie sich mit der Zeit.
Heute geht sie in vielen Bundesländern nicht mehr nur
Koalitionen mit der SPD ein, sondern weist eine hohe
und lagerübergreifende Kooperationsbereitschaft und
Koalitionsflexibilität auf.
Fragt man nach den programmatischen Positionen der
Parteien in Deutschland, so gilt, dass sich das Parteiensys-
tem in aktuellen politikwissenschaftlichen Analysen vor
allem durch zwei zentrale Konfliktlinien charakterisieren
und verdichten lässt: Das ist erstens in der sozioökono-
mischen Dimension der Gegensatz von Staat und Markt,
also die Betonung von marktwirtschaftlichen Freiheiten
gegenüber Forderungen von staatlicher Steuerung, sowie
zweitens auf einer kulturellen oder gesellschaftspoliti-
schen Achse der Gegensatz autoritärer (z.B. Kollektiv,
Hierarchie, Traditionalismus) und libertärer Wertorien-
tierungen (z.B. Individualismus, besonderer Fokus auf
gesellschaftliche Minderheiten). Platziert man die Par-
teien auf Grundlage einer systematisch-vergleichenden
Auswertung ihrer Wahlprogramme zur Bundestagswahl
2013 in diesem Raum, so zeigt sich erkennbar ein lin-
kes Lager, welches in Richtung des libertären Pols wie
hin zu stärkerer staatliche Steuerung tendiert, sowie ein
rechtes, konservatives Lager aus Union und FDP, das ins-
gesamt sehr mittig im Koordinatensystem platziert ist.
Nur anhand dieser Positionen würde man erwarten, dass
sich SPD, Linke und Bündnis 90/Die Grünen durchaus
programmatisch auf ein Bündnis verständigen könnten.
Auch die neu gegründete und bei Landtagswahlen kurz-
zeitig überaus erfolgreiche Piratenpartei, die allerdings
2017 mit dem Verlust ihrer letzten Landtagsfraktionen
in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wieder
zu einer Kleinstpartei schrumpfte, ließ sich zumindest
ihrem Bundestagswahlprogramm nach eindeutig in die-
sem Lager verorten.
6
Die 2013 erstmals antretende Alter-
native für Deutschland (AfD) hingegen befand sich der
MARPOR-Programmanalyse nach – aus heutiger Sicht –
zunächst überraschend nah an der Mitte des Parteiensys-
tems. Allerdings war damals noch Parteigründer Bernd
Lucke Vorsitzender, der vor allem auf Euro- und EU-
Kritik setzte und der 2015 die AfD verließ; die Partei hat
seitdem deutlich andere Schwerpunkte gesetzt und sich
erkennbar in Richtung des autoritären Pols bewegt.
7
6 Vgl. Christoph Bieber/Claus Leggewie (Hg.): Unter Piraten. Erkundungen
in einer neuen politischen Arena, Bielefeld 2012.
7 Vgl. Simon Franzmann: Von der Euro-Opposition zur Kosmopolitismus-
Opposition. Der Fall der deutschen AfD. In: Lisa Anders/Henrik Scheller/
Thomas Tuntschew (Hg.): Parteien und die Politisierung der Europäischen
Union, Wiesbaden 2017.
Beispielrechnung: Minimale Gewinnkoalition
Partei A Partei B Partei C Partei D
40 Sitze
30 Sitze
20 Sitze
5 Sitze
Bei dieser fiktiven Sitzverteilung hat das Parlament 95 Sitze.
Für eine absolute Mehrheit sind 48 Sitze nötig. Aus der rein
arithmetischen Perspektive der Koalitionstheorie würde sich
in dieser Situation ein Bündnis aus Partei B und Partei C for-
mieren. Zusammen kommen die Parteien mit 50 Sitzen auf
eine knappe Mehrheit. Sowohl Partei B wie Partei C kann in
dieser Konstellation mehr Ministerämter beanspruchen, als
wenn eine von ihnen mit Partei A als stärkster Partei eine
Regierung bilden würde. Partei D spielt bei der Koalitionsbil-
dung keine Rolle, da eine Einbeziehung keinen Unterschied
für das Erzielen einer Sitzmehrheit macht.


















