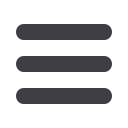

70
Rezeption der Weißen Rose in der Sowjetischen Besatzungszone und frühen DDR
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
Auch wenn die Weiße Rose und vor allem die Geschwister
Scholl in den 1950er Jahren in der offiziellen ostdeutschen
Gedächtniskultur zum deutschen Widerstand im Natio-
nalsozialismus nicht mehr die zentrale Stellung einnahmen
wie in den Jahren zuvor, so ist aber doch davon auszuge-
hen, dass aufgrund der historischen Nähe und der frühen
Etablierung in der deutschen Erinnerungslandschaft die
Münchner Widerstandsgruppe für die Jugend in der DDR
prägend blieb. Klaus Dobrisch, seit 1958 Mitarbeiter am
Institut für Deutsche Geschichte der Deutschen Akademie
der Wissenschaften zu Berlin und seit 1972 am Zentral-
institut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften
der DDR, veröffentlichte 1968 „Eine Dokumentation
über den antifaschistischen Kampf Münchner Studenten
1942/43“. Diese Textsammlung war „anläßlich des 25. Jah-
restages der letzten Aktion der Münchner Studenten und
der Ermordung der Geschwister Scholl erschienen, wurde
von den Ministerien für Kultur und Volksbildung und vom
Präsidium der Urania [
17
] in einem Preisschreiben zur För-
derung der populär-wissenschaftlichen Literatur 1968/69
mit einer Lobenden Anerkennung gewürdigt“. Unter der
Rubrik „Lebendiges Erbe“ belegte der Autor in immer wie-
der aktualisierten Neuauflagen bis 1983 eine aktive Erinne-
rungskultur für die Weiße Rose in der DDR:
„Lebendiges Erbe
Das Vermächtnis der Geschwister Scholl lebt in der Deut-
schen Demokratischen Republik und bei progressiven
Kräften in der Bundesrepublik Deutschland. In der Deut-
schen Demokratischen Republik gehört es zu den Ideen
der antifaschistischen Bewegung, die eine der Grundla-
gen ihrer Politik sind. Staat und Bevölkerung ehren und
achten die standhaften Kämpfer gegen Faschismus und
Krieg, Menschen, die in der Zeit der faschistischen Dik-
tatur ihrem Gewissen folgten und aus humanistischem
Geist gegen die Nazityrannei angingen. Denn das Volk in
diesem deutschen Staat hat eine menschliche Gesellschaft
aufgebaut und strebt nach ihrer Vervollkommnung.
Hier wird die Jugend auch im Sinne der Geschwister
Scholl erzogen. Die nach ihnen benannten Kindergär-
ten, Schulen, Universitätseinrichtungen, Jugendbrigaden,
Fabriken, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaf-
ten und Straßen sind Symbol hierfür. Schülerforschungs-
gemeinschaften und Gruppen junger Pioniere spüren
17 Die Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse, 1954–
1990, seit 1966 auch URANIA genannt, hatte die verständliche Verbrei-
tung wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Ziel und nutzte neben Publika-
tionen auch das DDR-Fernsehen.
immer wieder den Weg und den Absichten Sophie und
Hans Scholls nach. In der Freizeit und in Zirkeln sam-
meln sie alle erreichbaren Unterlagen und sprechen ange-
regt über ihre Vorbilder.
“
18
Deutsch-deutsche Erinnerungskonkurrenz
Bereits am 4. November 1945 hatte an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität in München (LMU München) eine
erste Gedenkveranstaltung in Erinnerung an die Weiße
Rose stattgefunden, in den kommenden Jahren wurde hier
der 22. Februar, ebenso wie in Ostdeutschland, zum offi-
ziellen Gedenktag. Während noch in den späten 1940er
Jahren in der SBZ und dann in der frühen DDR Gedenk-
veranstaltungen an die Weiße Rose staatsgelenkt an ver-
schiedenen Orten durchgeführt wurden, konzentrierte
sich die Erinnerungsarbeit in der jungen Bundesrepublik
auf und um die Münchner Universität. Dabei entwickelte
sich im zunehmenden Ost-West-Konflikt auch eine Erin-
nerungskonkurrenz.
Die Teilnahme einer Delegation Jenaer Studenten an
der Gedenkfeier in München 1959 hatte bereits zu Dis-
kussionen zwischen den Studierenden aus Ost- und West-
deutschland geführt. Im folgenden Jahr kam es mit der
Jenaer Studentenabordnung bei der Trauerfeier erneut zum
Konflikt, weshalb die Hochschulgruppenleitung der FDJ
eine „Erklärung abzugeben“ beschloss. Darin begründete
sie zunächst die Teilnahme an der Münchner Gedenkveran-
staltung damit, „daß gerade heute das Vermächtnis des anti-
faschistischen Widerstandskampfes unteilbar in die Hände
aller aufrechten Menschen in beiden Teilen Deutschlands
gelegt ist“. Empört war man über den Umgang mit der
Jenaer Abordnung, die „im Einverständnis mit dem Rek-
tor und dem Allgemeinen-Studenten-Auschuß (ASTA) der
Universität München“ angereist war:
„In den Nachmittagsstunden des 22. Februar 1960
schändete eine siebenköpfige Gruppe reaktionärer Stu-
denten, von denen sechs dem Ring Christlich-Demokra-
tischer Studenten (RCDS) und einer der faschistischen
deutschen Reichspartei (DRP) angehörten, die Gedenk-
stätte im Lichthof der Universität, indem sie die Schleife
unseres Kranzes mit dem Text ‚Sophie und Hans Scholl,
den Kämpfern gegen Faschismus und Krieg‘ abschnitten
und anschließend den Kranz entfernten.“
19
18 Klaus Drobisch: Wir schweigen nicht. Die Geschwister Scholl und ihre
Freunde, 3. überarbeitete und ergänzte Auflage, Berlin 1977, S. 63.
19 Anonymus: Jenaer Studenten – Sachwalter des Vermächtnisses der Ge-
schwister Scholl, in: Sozialistische Universität, S. 1 u. 4. Die folgenden Zita-
te stammen ebenfalls aus diesem Zeitungsbericht.


















