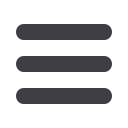
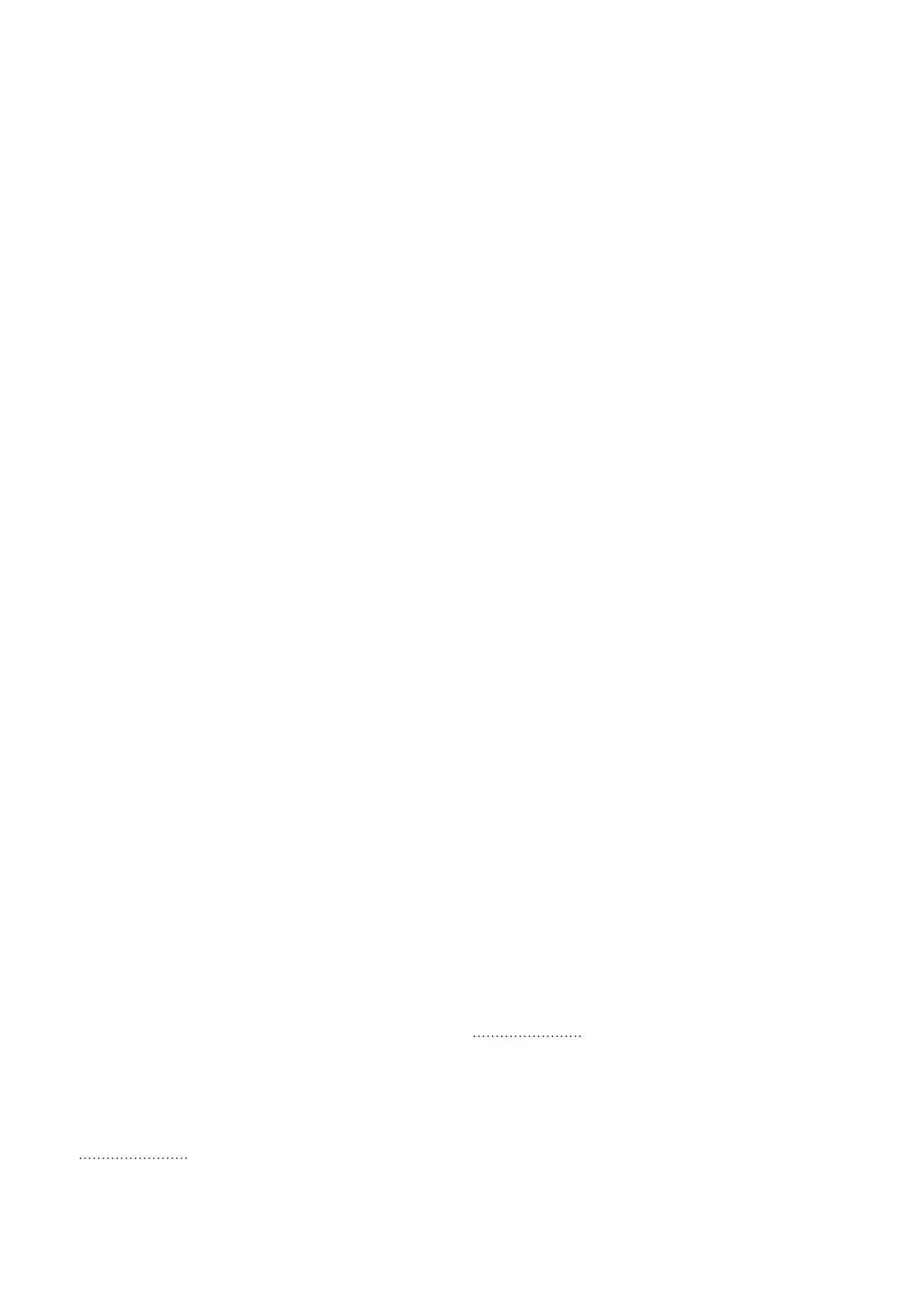
73
Rezeption der Weißen Rose in der Sowjetischen Besatzungszone und frühen DDR
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
Achim Beyer erinnert sich an diese „unbeabsichtigte Moti-
vation“:
Unbeabsichtigte Motivation
29
„In der OberschuleWerdau wurde insbesondere vom Schul-
leiter Heß und anderen Lehrern jegliche politisch ‚nicht
linientreue‘ Meinungsäußerung mit der Androhung emp-
findlicher Schulstrafen unterbunden – dies konnte bis zur
Relegierung gehen. Gleichzeitig motivierte uns der Schullei-
ter ungewollt zur politischen Opposition durch seine stän-
dige Verklärung des kommunistischen Widerstandes gegen
die NS-Diktatur. Widerstand gegen eine Diktatur – so
seine Botschaft – sei notwendig und ehrenvoll. Nur verstan-
den der Schulleiter und seine SED-Genossen in der Lehrer-
schaft nicht, dass viele von uns zu vergleichen begannen
und viele Ähnlichkeiten zwischen der NS-Diktatur und der
politischen Entwicklung in der DDR erkannten. In einem
vertraulichen Bericht der SED-Landesleitung Sachsen […]
heißt es, der Schulleiter Heß habe ‚so berichtet, daß die
Schüler daraus den Schluß ziehen konnten, daß eine solche
Arbeit auch heute noch eine mutige Tat ist‘.
Zur sogenannten antifaschistischen Erziehung gehörte
es, uns mit der Geschichte der Geschwister Scholl aus
München und ihren Flugblättern vertraut zu machen.
[…] Bei der Lektüre ihrer Flugblätter aus dem Jahre 1943
wurde uns die Ähnlichkeit zwischen dem NS-Regime
und dem Stalinismus von 1950 besonders offenkundig:
ein Austausch der Begriffe NSDAP gegen SED, ‚Hitlerju-
gend‘ (HJ) gegen FDJ, Gestapo gegen Stasi drängte sich
geradezu auf. Damit erschien der politische Widerstand
gegen die NS-Diktatur für uns in einem völlig anderen
Licht: Es ging nicht mehr nur um eine überwundene Ver-
gangenheit – es ging auch um die gegenwärtige politische
Entwicklung. Die Geschwister Scholl wurden für viele
Jugendliche zum Vorbild – und dies nicht nur in Werdau,
sondern an vielen anderen Orten der DDR.“
Die Folgen für die Jugendlichen waren fatal: Hans-Joa-
chim Näther wurde mit dreien seiner Mitstreiter zum
Tode verurteilt und am 12. Dezember 1950 in Moskau
hingerichtet. Zusammen mit 18 Mitangeklagten wurde
Achim Beyer 1951 zu insgesamt 130 Jahren Zuchthaus-
strafe verurteilt und erst am 4. Oktober 1956 zu seinem
24. Geburtstag aus schwersten Haftbedingungen ent-
lassen. In Zusammenhang mit diesen und vielen ande-
29 Achim Beyer: Urteil: 130 Jahre Zuchthaus. Jugendwiderstand in der DDR und
der Prozess gegen die „Werdauer Oberschüler“ 1951, Leipzig 2008, S. 22ff.
ren Unrechtsurteilen klingt der zitierte Rütli-Schwur –
„Eher den Tod als in der Knechtschaft leben!“ – im zuvor
genannten Artikel von Egon Rentzsch geradezu zynisch.
Im Folgenden werden zwei weitere Beispiele für die Wahr-
nehmung der „Weißen Rose“ im Jugendwiderstand der
SBZ und frühen DDR vorgestellt.
U
niversität Leipzig
30
Unmittelbar nach Kriegsende zeichnete sich bei ersten Stu-
dentenversammlungen an der Universität Leipzig eine klare
Lagerbildung ab. Den Universitätsgruppen von KPD und
SPD stand ein bürgerliches Bündnis aus CDU und LDP
(Liberal-Demokratische Partei Deutschlands) gegenüber.
Diese Spaltung der Leipziger Studentenschaft setzte sich in
den kommenden Jahren fort und vertiefte sich sogar zum
Nachteil des linken Lagers, dann von SED und FDJ ange-
führt. Bei denWahlen zum Studentenrat mit 21 Sitzen am 6.
Februar 1947 brachten CDU und LDP jeweils sechs Vertreter
ein, während die SEDmit acht Abgeordneten unterlegen war
(ein Mitglied war parteilos). Die folgenden Wahlen am 12.
Dezember des Jahres fielen noch deutlicher aus: Im nun drei-
ßigköpfigen Studentenrat erhielt die LDP elf, die CDU neun
und die SED acht Sitze (zwei Mitglieder waren parteilos).
Hintergrund der Lagerbildung an der Leipziger Univer-
sität war vor allem die Frage nach den Zulassungsbedingun-
gen für Studierende. Während sich die KPD gegenüber der
„Bauern- und Arbeiterklasse“ beim „antifaschistisch-demo-
kratischen Neuaufbau“ verpflichtet fühlte und eine Privile-
gierung von „Bauern- und Arbeiterstudenten“ vorsah, plä-
dierte das bürgerliche Lager, bei Anerkennung einer gewissen
Förderung bisher vernachlässigter Bevölkerungsschichten,
für eine gleichberechtigte Behandlung der Studierenden.
Bereits am 1. Dezember 1947 hatte Wolfgang Nato-
nek,
31
der als Vertreter der LDP dem Studentenrat vor-
stand, auf einem ersten Parteitag der LDP in Bad Schandau
pointiert formuliert: „Es gab einmal eine Zeit, in der der
verhindert war zu studieren, der eine nichtarische Groß-
mutter hatte. Wir wollen nicht eine Zeit, in der es dem ver-
hindert wird zu studieren, der nicht über eine proletarische
Großmutter verfügt.“
32
30 Mein ausdrücklicher Dank gilt Mike Schmeitzner, der mich auf die Exis-
tenz der Unterlagen im BStU hingewiesen hat. Ausführliche Darstellung
der Hintergründe an der Leipziger Universität finden sich in Günther Hey-
demann: Die Leipziger Studentenschaft 1945–1961, in: Ulrich von Hehl
u.a. (Hg.): Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009, Band 3, Das
zwanzigste Jahrhundert 1909–2009, Leipzig 2010, S. 443–504.
31 Siehe Klaus-Dieter Müller/Wolfgang Natonek, in: Fricke (wie Anm. 27),
S. 181–186.
32 Zit. nach Heydemann (wie Anm. 29), S. 478.


















