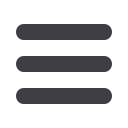

75
Rezeption der Weißen Rose in der Sowjetischen Besatzungszone und frühen DDR
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
„Die Zeit liegt noch nicht weit hinter uns, da in Deutsch-
land mit gleichen Terrormethoden verfahren wurde. Wir
haben aus den Jahren 1933 bis 1945 gelernt und sich [sic!,
sind] nicht gewillt, uns dereinst wieder fragen zu lassen:
Was habt ihr denn gegen die Unterdrückung, für die Frei-
heit getan?
Kommilitonen!
Es gilt nicht, unser Studium – es gilt, unsere Freiheit und
die Freiheit der Millionen Menschen unserer Zone zu ver-
teidigen! […]
Alle Kommilitonen aber, die aus egoistischen Gründen,
aus Verblendung, aus Unwissenheit oder ‚Idealismus‘ der
SED beigetreten sind, rufen wir zu: Denkt nach über die
Versprechungen, die man Euch macht, denkt nach über
die hinter uns liegende Zeit der Nazi-Diktatur! Vergleicht
die Terrormethoden von einst und jetzt! Laßt Euch nicht
täuschen! Verschließt nicht Eure Augen!
Wir rufen die Universitäten der Ostzone, wir rufen Berlin,
wir rufen alle Menschen unserer Zone, die die Freiheit lieben!
Die erste Widerstandsgruppe
der Universität Leipzig.“
Auch wenn hier nicht die Weiße Rose als unmittelbarer
Bezugspunkt genannt ist, so klingt in den Formulierun-
gen der Geist der Münchner Widerstandsgruppe mit,
der diesen Aufruf zum Protest begleitet. Ausdrückliche
Erwähnung findet die Weiße Rose schließlich in einem
kürzeren Flugblatt aus derselben Zeit, das auf ganz asso-
ziative Weise Schlagworte einsetzte, die allen Lesern vor
dem Hintergrund des Nationalsozialismus klar lesbare
Chiffren gewesen sein müssen:
„Studenten!
Denkt an die Geschwister Scholl!
Demokratie heißt: Verantwortung vor dem Volk!
Schweigen Schuld“
Ein weiterer Bezug zur Weißen Rose findet sich in einem
anonymen Schreiben an Horst Grimmer (1899–1975),
das bereits am 5. November 1948 verfasst wurde. Grimmer
war bis 1933 Mitglied im sozialdemokratisch dominierten
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und seit 1945 Mitglied
der SPD, dann 1946 Mitglied der SED. 1946 hatte er die
Professur für Pädagogik, Didaktik und Schulkunde an der
Universität Leipzig übernommen. In dem Anschreiben
wurde versucht, Grimmer für eine Stellungnahme zu einer
„illegalen SPD“ zu gewinnen. Abschließend hieß es:
„Wir hoffen auf die innere Stärke Ihrer sozialistischen
Anschauung und vertrauen auf Ihre Ehre als Professor
einer deutschen Universität. Bitte entschließen Sie sich
und schweigen Sie, im Gedanken an die Geschwister
Scholl, gegen Jedermann.“
Ebenfalls rein assoziativ, geradezu nebenbei, wurde hier
die Erinnerung an die Weiße Rose geweckt. Und wie dem
heutigen Leser die Worte von Kurt Huber aus seiner Ver-
teidigungsrede vor dem Volksgerichtshof – „Als deutscher
Staatsbürger, als deutscher Hochschullehrer und als poli-
tischer Mensch erachte ich es als Recht nicht nur, sondern
als sittliche Pflicht, …“ – in den Sinn kommen, so mag
diese kurze Bemerkung auch beim damaligen Adressa-
ten Erinnerungen geweckt haben. Ob das im Schreiben
erwünschte Telefonat stattgefunden hat, ist aufgrund der
jetzigen Quellenlage nicht nachvollziehbar, der Verbleib
des Schreibens in den Staatssicherheitsunterlagen (damals
noch K5) lässt anderes vermuten.
Die Umstände der Herstellung und der Verteilung
dieser Schreiben sowie die Hintergründe ihrer Entste-
hung oder gar die Autoren sind heutzutage nur schwer
zu ermitteln. Bedeutsam an sich ist ihre Existenz als Beleg
der Bereitschaft zum Widerstand in der SBZ und frühen
DDR. Des Weiteren sind hier die Verweise auf die Weiße
Rose beachtenswert, die im Gegensatz zur ideologischen
Verwertung im ostdeutschen Sozialismus – mit ausführ-
lichen Darstellungen, Analogien und Umdeutungen –
allein assoziativ wirken sollten. Ein Beleg dafür, dass der
Widerstand der Weißen Rose weithin bekannt war, und
Appelle zum Handeln und für die Freiheit nur knapper
Erwähnungen bedurfte.
Wolfgang Natonek wurde in einem Unrechtsverfahren
von einem sowjetischen Gerichtstribunal zu 25 Jahren
Haft verurteilt, die er im Speziallager Bautzen und in der
Haftanstalt Torgau verbrachte. 1956 wurde Natonek nach
mehreren Gnadengesuchen vorzeitig freigelassen und floh
mit seiner Frau, Christa Göhring, nach Westdeutschland.
Flugblatt vom 30.11.1948
Quelle: BStU


















