
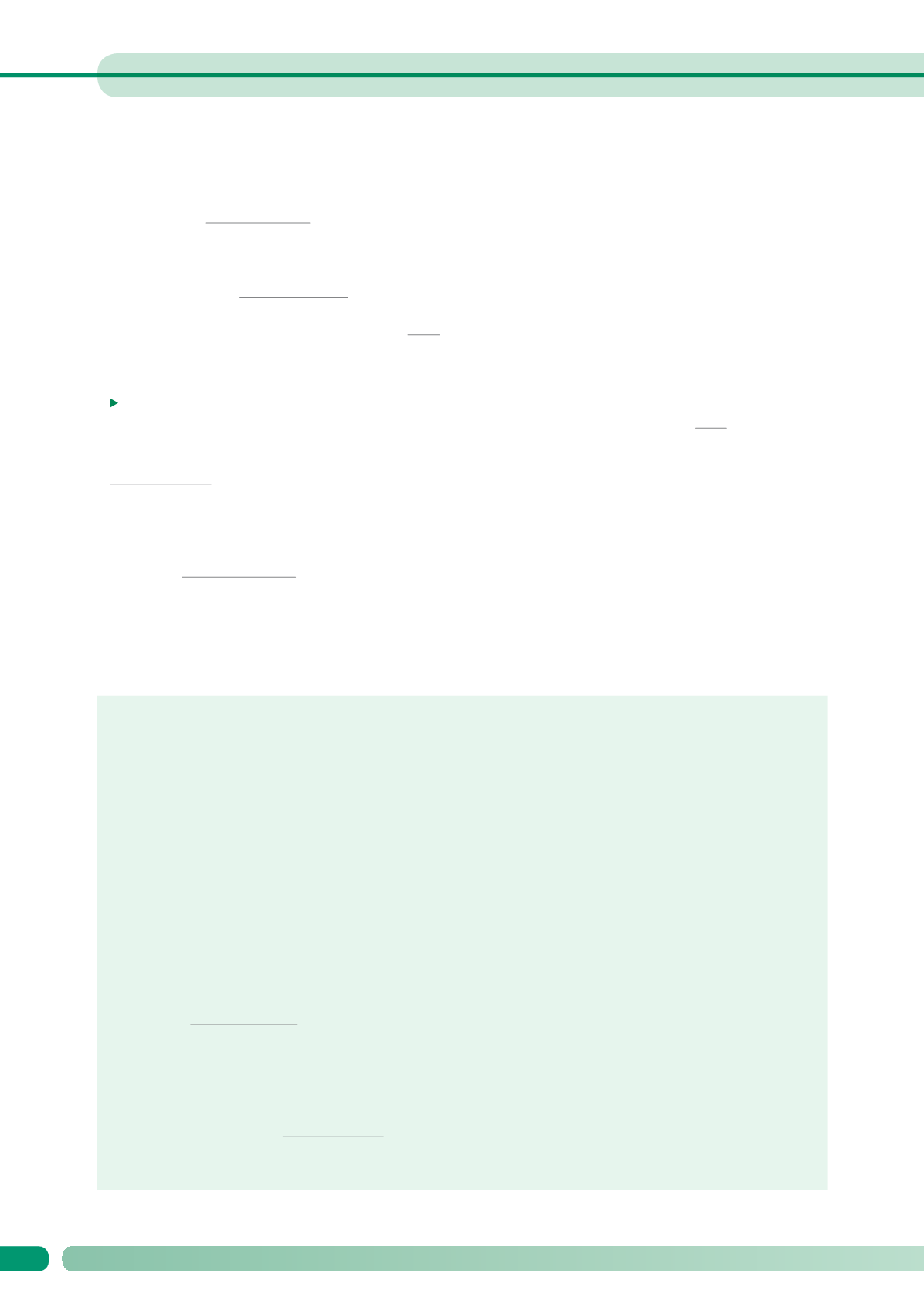
26
•
Gespräch mit dem Therapeuten, welche Rücksichtnahmen aus dessen Sicht in der Schule gegenüber Sebastian besonders
notwendig sind und welche Verhaltensweisen von Sebastian eingefordert werden können
•
Kontakt mit der Schule für Kranke, um Informationen über den Umgang mit dem Krankheitsbild zu erhalten und mögliche
Unterstützungsangebote für die Arbeit mit dem Schüler, der Klasse und für den Klassenelternabend abzusprechen
2. Konkrete Vorbereitung der Rückkehr des Schülers an die Schule:
•
enger Austausch des Schulpsychologen mit der Schulleitung über den Termin der Rückkehr des Schülers
•
zeitnahe Einberufung einer Klassenkonferenz zur Weitergabe zentraler Informationen, Absprache über einen Klassen
lehrernachmittag, an dem unter Hinzuziehen des MSD Autismus Handlungsstrategien im Umgang mit dem Schüler
während des Unterrichts durchgesprochen werden
-
•
Durchführung eines Klassengesprächs unmittelbar vor Rückkehr des Schülers mit dem Ziel des Abbaus von Unsicherheiten
und des Aufbaus gegenseitiger Achtsamkeit (siehe MSD-Infobriefe Autismus-Spektrum-Störung besonders Kapitel A9:
www.isb.bayern.de/download/14848/ass_a9_aufklaerung.pdf)•
Planung und Durchführung eines Klassenelternabends unter Hinzuziehung externer Experten (z.B. MSD Autismus)
3. Weitere – ggf. längerfristige – Begleitung der Klasse:
•
Schulpsychologe als benannter, im Hintergrund präsenter Ansprechpartner
•
ggf. erneute Einzel- oder Gruppengespräche mit der Klasse, mit Lehrkräften und Erziehungsberechtigten
•
ggf. unterschiedliche Formen von Psychoedukation
Das Beispiel verdeutlicht in besonderer Weise, dass ein Teil des Inklusionsprozesses die Arbeit an Haltungen ist. Dies betrifft
einerseits die Beratungsfachkraft, die konsequent eine Haltung der Allparteilichkeit verkörpern muss. Es ist ihre Aufgabe,
dass die Bedürfnisse und Nöte jeder einzelnen Partei beachtet werden und im Rahmen des Prozesses gegenüber allen
formuliert werden können und gehört werden. Damit wird sie gleichzeitig zu einem Modell für Haltungen, die bei Inklusions
prozessen schrittweise von allen Beteiligten entwickelt werden sollten, um eventuell immer wieder entstehende Konflikte
konstruktiv austragen und durchstehen zu können. Dies beinhaltet in besonderer Weise das Erleben eines Perspektiven
wechsels und das nachvollziehende Verstehen anderer Sichtweisen.
-
-
Besondere Hinweise zum Elternabend:
In Abgrenzung zur Gestaltung herkömmlicher Elternabende empfiehlt sich, im Vorfeld dieser besonderen Klasseneltern
versammlung folgende Aspekte besonders zu bedenken:
-
Voraussetzung ist das Gespräch mit den Erziehungsberechtigten des betroffenen Kindes:
•
Erörtern Sie mit den Erziehungsberechtigten, ob auch die Erziehungsberechtigten der anderen Schüler über die
Besonderheiten autistischer Verhaltensweisen Bescheid wissen sollten. Das hat häufig Vorteile, z.B. für das soziale
Miteinander in der Klasse.
•
Klären Sie ab, ob die Erziehungsberechtigten damit einverstanden sind, dass das Verhalten ihres Kindes konkret
thematisiert wird.
•
Erfragen Sie, welche Rolle die Erziehungsberechtigten an diesem Abend übernehmen wollen (Teilnahme, Sprech
anteile, zur Verfügung stehen bei Fragen?).
-
•
Gewinnen Sie eine Einschätzung darüber, wie die Erziehungsberechtigten selbst über die Erkrankung ihrer Tochter/
ihres Sohnes denken.
Entscheidend für die Planung ist eine bewusste Zielformulierung:
•
Informieren Sie fachlich und behutsam über das Krankheitsbild.
•
Schaffen Sie eine Gesprächsatmosphäre, in der es für alle Beteiligten möglich ist, Ängste und Meinungen auszu
sprechen; Verschwiegenheit ist Voraussetzung.
-
•
Beschreiben Sie die aktuelle Sachlage der Klasse und geben Sie Ausblick auf mögliche Situationen.
•
Machen Sie deutlich, dass durch den besonderen Umgang mit einem Kind/einem Jugendlichen (z.B. Gewährung
eines Nachteilsausgleichs) die anderen keine Nachteile erfahren.
•
Öffnen Sie den Blick auf die Chancen, die sich für alle Kinder/Jugendlichen im Umgang mit Behinderung ergeben
können.
Grundsätzlich muss sich der Schulpsychologe damit auseinandersetzen, dass Kritik, Forderungen aber auch Gefühle die
Diskussion bestimmen können. Deshalb ist es sinnvoll und wichtig, die eigene Haltung im Vorfeld zu überdenken und
eine Position zu finden.



















