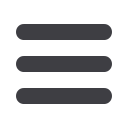
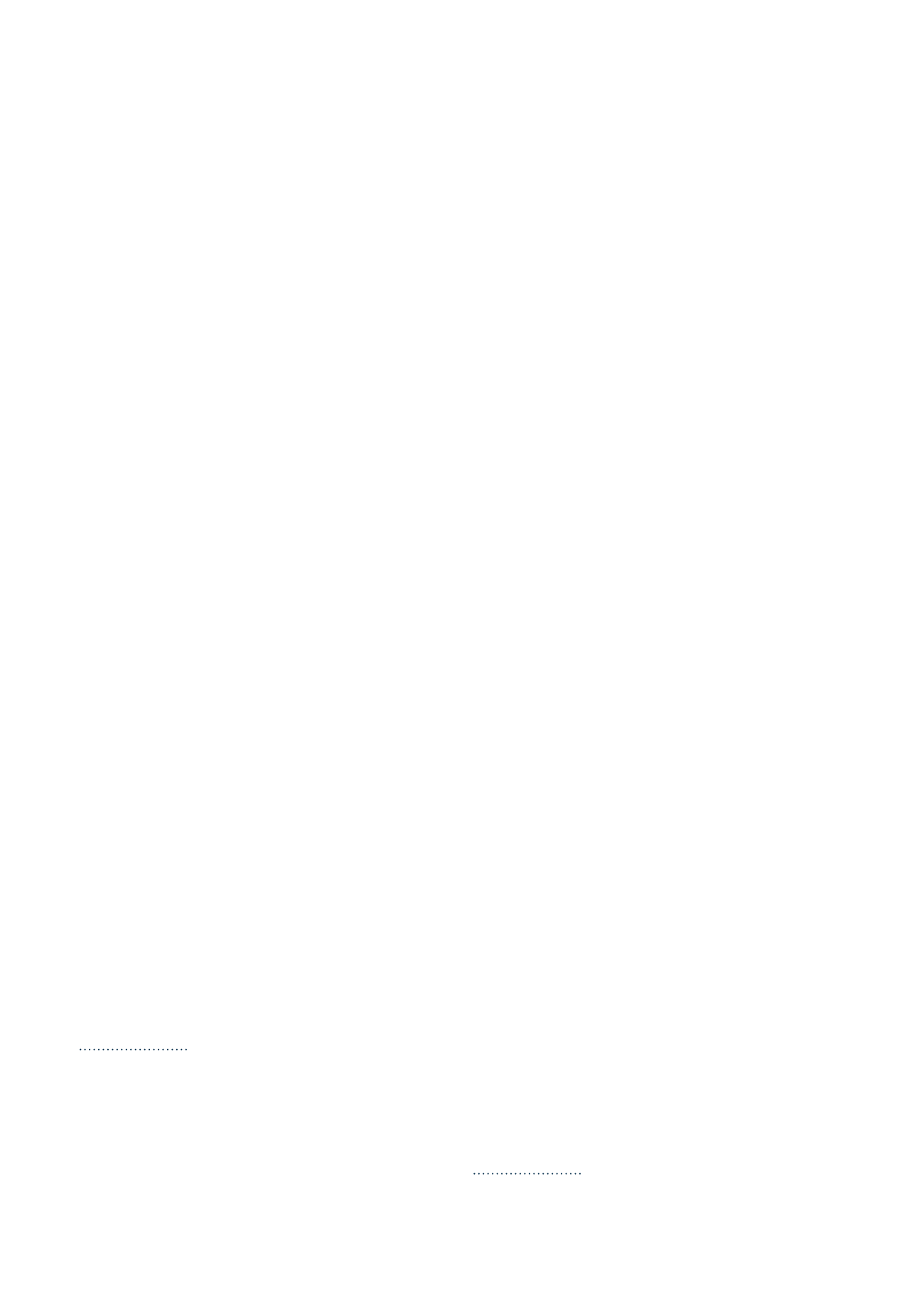
28
Der Russische Revolutionszyklus 1905–1932
Einsichten und Perspektiven 2 | 17
lismus erwies sich meist noch recht dehnbar, weil sozialis-
tische Theorien im Kessel der Gesellschaft zu emotionalen
Losungen und Parolen eingekocht wurden. Gleichwohl
veränderten die Arbeiter allmählich ihr Protestverhalten.
Waren lange Zeit spontane, meist wenig koordinierte
Gewaltausbrüche in Form von Krawallen, Pogromen,
Plünderungen und Maschinenstürmerei Dauermerkmale
der Arbeiterunruhen gewesen, griffen die Arbeiter zu
Beginn des 20. Jahrhunderts zunehmend auf moderne
Widerstandspraktiken wie Streiks, Arbeitsniederlegungen
und Boykott zurück. Aus den Arbeiterversammlungen,
den Demonstrationszügen und den Generalstreikaktionen
verschwanden die zuvor eifrig geschwenkten Zarenbilder;
die rote Fahne begann zu dominieren. Zugleich gelang
es, den zuvor rein ökonomischen Kampf der Fabrikbeleg-
schaften um bessere Arbeitsverhältnisse in eine politische
Rebellion gegen das zarische Regime zu überführen. Die
russischen Fabrikarbeiter machten darum bald mit der
europaweit höchsten Streik- und Protestbereitschaft auf
sich aufmerksam.
Auch wenn die soziale Metamorphose vom Arbeiter-
bauern zum klassenbewussten Proletarier bis 1914 bei
weitem noch nicht abgeschlossen war und zahlreiche
Spuren dörflicher Kultur weiterhin das Leben in Stadt
und Fabrik prägten, so spiegelte die wachsende Nervo-
sität und Brutalität der Machthaber doch die Tatsache,
dass sich die Industriearbeiterschaft politisiert hatte
und zu einem Herd der Unruhe und des Aufbegehrens
geworden war. Von Staat und Gesellschaft ausgeschlos-
sen, blieben die Arbeiter in ihrer sozialen Randlage
ein Fremdkörper, der sich nicht in die überkommene
Ordnung des Zarenreichs integrieren ließ und deshalb
eine besondere politische Schlag- und Sprengkraft ent-
wickelte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeichnete
sich immer deutlicher ab, dass bei der Zuspitzung der
revolutionären Situation zukünftig der nun besser orga-
nisierten Fabrikarbeiterschaft eine entscheidende Rolle
zufallen würde.
87
87 Bonwetsch (wie Anm. 77), S. 79–94; Victoria V. Bonnell: Roots of Rebel-
lion. Workers’ Politics and Organisations in St. Petersburg and Moscow,
1900–1914, Berkeley 1983; Charters Wynn: Workers, Strikes and Pogroms.
The Donbass-Dnepr-Bend in Late Imperial Russia, 1870–1905, Princeton
1992; Deborah L. Pearl: Creating a Culture of Revolution. Workers and the
Revolutionary Movement in Late Imperial Russia, Bloomington 2015; Ali-
ce K. Pate: Workers and Unity. A Study of Social Democracy, St. Petersburg
Metalworkers, and the Labor Movement in Late Imperial Russia, 1906-14,
Bloomington 2015.
Modernisierung als Problem und die Interpretation
der Revolution
Seit den „Großen Reformen“ waren im Zarenreich nicht
nur Wirtschaft und Gesellschaft, sondern auch die poli-
tische Landschaft in Bewegung geraten. Die sich immer
mehr zuspitzenden Strukturkrisen in der Stadt und auf
demLand hatten eine explosive Gemengelage sozialer und
politischer Konflikte entstehen lassen, die sich bislang
nur in lokalen Protest- und Gewaltaktionen äußerten.
Meist im Untergrund hatten sich mit (im europäischen
Vergleich) großer Verspätung und schweren Geburtswe-
hen politische Parteien gegründet, die zunächst weitge-
hend noch in sich geschlossene Gesinnungsgemeinschaf-
ten darstellten. Deren Repräsentanten erhoben zwar den
Anspruch, die Interessen gesellschaftlicher Gruppen zu
vertreten und den hohen Ausbeutungsdruck endlich
reduzieren zu wollen. Es fehlte ihnen in der Bevölkerung
aber weiterhin an Rückhalt und Akzeptanz, auch wenn
ihre Programme und Forderungen verstärkt auf die Nöte
und Wünsche der Menschen reagierten und damit zur
Politisierung vor allem der städtischen Bildungsschich-
ten und Arbeitergruppen beitrugen. Diese allgemeine
Schwäche des russischen Parteiwesens sollte für die wei-
tere politische Entwicklung eine schwere Hypothek dar-
stellen.
88
Das in seiner Machtfülle unbeschränkte Zarenregime
hatte sich so manchen Ausweg aus seiner selbst geschaf-
fenen Modernisierungskrise versperrt, weil seine obersten
Vertreter auf die sich bietenden Möglichkeiten der Par-
tizipation loyaler Elitenkreise und der staatlichen Mode-
ration sozialer Konflikte verzichteten. Die Autokratie
dachte nicht daran, die Folgen von Verstädterung und
Industrialisierung sozialstaatlich aufzufangen und sich
mit einer verbesserten Daseinsvorsorge ernsthaft um das
Schicksal der Bauern zu kümmern, deren Existenz unge-
achtet aller Anpassungsprozesse an die neuen Marktver-
hältnisse weiterhin prekär blieb. Für die Konfrontation
mit einer Gesellschaft, die sich allmählich ihrer Belange
und Kraft bewusst zu werden schien, erwies sich der
Zarenstaat als schlecht vorbereitet. Statt die Herausfor-
derungen des seit Ende des 19. Jahrhunderts auch im
Russischen Imperium beginnenden Aufbruchs in das
Industriezeitalter vorausschauend und umsichtig anzuge-
hen, erging sich die Autokratie in einer Politik der Gegen-
sätze und brach damit immer mehr Brücken sowohl
zur Gesellschaft als auch in die Zukunft hinter sich ab.
88 Geyer (wie Anm. 31), S. 43.


















