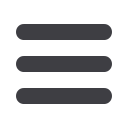
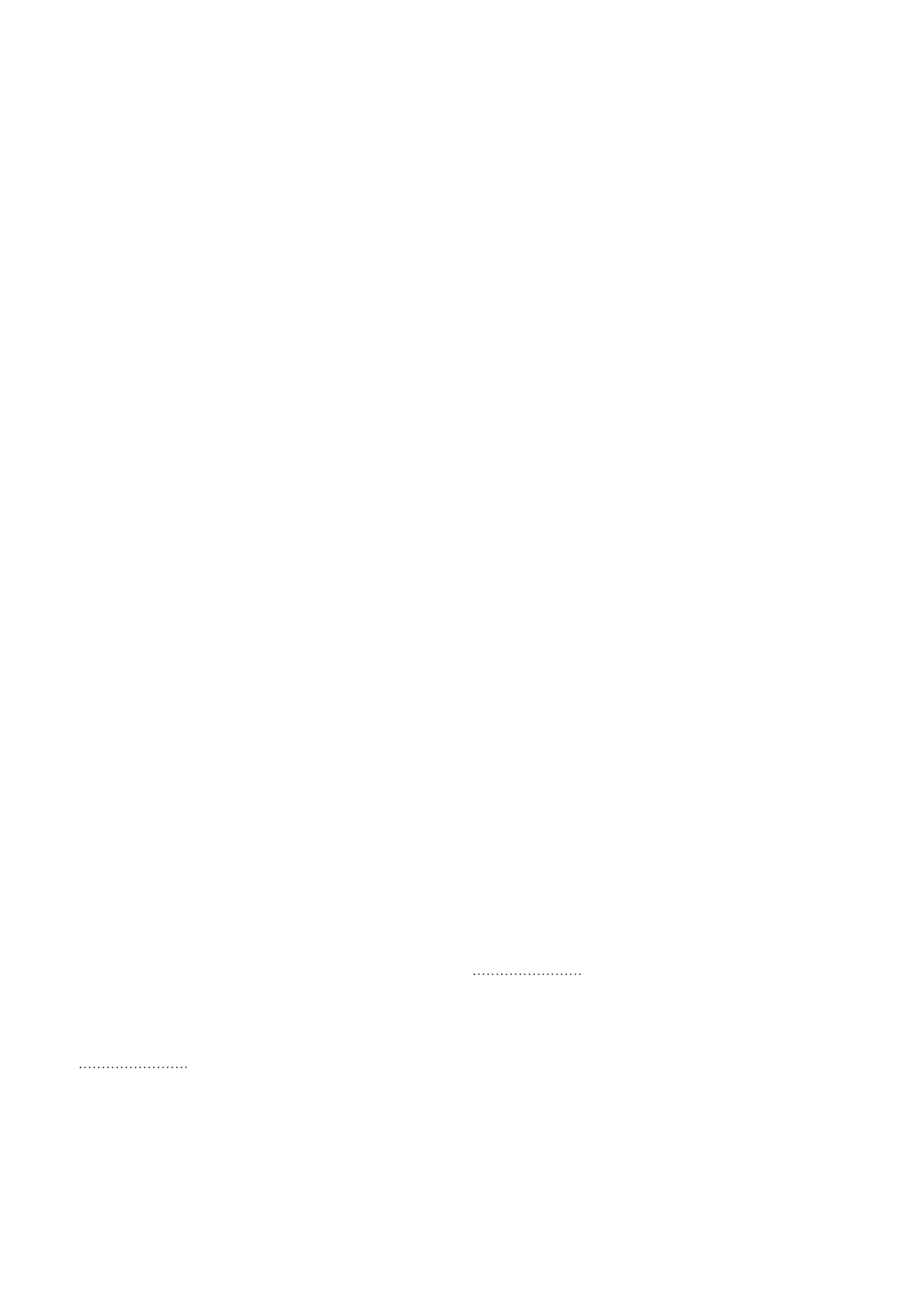
30
Der Russische Revolutionszyklus 1905–1932
Einsichten und Perspektiven 2 | 17
reformieren beginnt.“
92
Auf diesen engen Zusammen-
hang von Reform und Revolution macht die Geschichte
des ausgehenden Zarenreichs nachdrücklich aufmerksam.
Angesichts des epochalen Umbruchs von der Agrar- zur
Industriegesellschaft, dem sich das Zarenreich nicht ent-
ziehen konnte, entwickelte sich mit den „Großen Refor-
men“ die Modernisierung von einer Herausforderung zu
einem sich verschärfenden Problem. In diesem Transfor-
mationsprozess sind die Voraussetzungen der Russischen
Revolutionen zu suchen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellte Russland das Para-
debeispiel für ein tief zerrissenes und auseinanderdriftendes
Zeitsystem dar. Einerseits zu einem erhöhten industriellen
Entwicklungstempo fähig, stemmte sich der Zarenstaat
andererseits erbittert dessen politischen und gesellschaft-
lichen Konsequenzen entgegen. Er „baute Dämme, aber
brauchte Kanäle.“
93
Aus dieser gespaltenen Modernisierung
ergeben sich zwei unterschiedliche Interpretationsmuster,
die entweder ein Zuwenig an politischem Wandel oder ein
Zuviel an sozioökonomischem Wandel für das Heraufzie-
hen der revolutionären Situation verantwortlich machen.
Vertreter der ersten Sichtweise betonen, dass es Russ-
land zwar gelungen sei, die Rückständigkeit im Bereich
von Industrialisierung, Urbanisierung und Professionali-
sierung zu reduzieren. Selbst der Massenanalphabetismus
sei spürbar zurückgegangen. Auf ihre überkommenen Pri-
vilegien pochend, hätten sich die alten Machthaber aber
dem allgemeinen Strukturwandel und dem Anbruch einer
neuen Zeit verweigert und sich der Illusion hingegeben,
man könne immer mehr Fabriken eröffnen, brauche aber
kein Parlament einzuberufen. Daher sei die Transforma-
tion von einem ständischen Untertanenverband hin zu
einer mündigen Staatsbürgergesellschaft auf halbem Weg
steckengeblieben. Die russische Geschichte zu Ende des
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts biete demnach
kein Bild eines allgemeinen Niedergangs, sondern viel-
mehr nur eines zunehmenden Verfalls des traditionellen
Zarismus, der seine eigene Modernisierung aussparte und
dadurch schwer auflösbare Antagonismen sowie massive
Autoritätsverluste und Legitimitätsprobleme heraufbe-
schwor.
94
92 Alexis de Tocqueville: Der alte Staat und die Revolution, München 1978,
S. 176 (3. Buch, Kapitel 4). Dazu auch Robert T. Gannett: The Shifting
Puzzles of Tocqueville’s The Old Regime and the Revolution, in: Cheryl B.
Welch (Hg.): The Cambridge Companion to Tocqueville, Cambridge 2006,
S. 188–215.
93 Christoph Schmidt: Russische Geschichte 1547–1917, München 2009, S. 195.
94 Neutatz (wie Anm. 38), S. 87.
Die zweite Sichtweise geht von einer Skepsis gegenüber der
Vorstellung modernisierender Unbedingtheit aus. Sie richtet
den Blick stärker auf die inneren Widersprüche Russlands
bei seinem Gang ins Industriezeitalter und damit auf den
tiefen Bruch, der ins Mark der Geschichte des Zarenreichs
seit der von Peter dem Großen zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts erzwungenen Öffnung des Landes führt. Die in der
Forschung oft verwandte Kategorie der Rückständigkeit
messe Russland an Kriterien, die es eigentlich nicht kannte,
und gehe von Voraussetzungen aus, die im Zarenreich
aber nicht gegeben wären.
95
Importierte Ideologien und
Technologien hätten sowohl die Bevölkerung als auch das
autokratische Regime unter zu hohen Veränderungsdruck
gestellt. Die Russischen Revolutionen müssten darum als
die Kulmination von Konflikten zwischen überschießenden
Reformambitionen und den weiterhin bestehenden vormo-
dernen Strukturen Russlands verstanden werden. Bei dieser
Sichtweise erfolgte die Modernisierung also nicht zu zaghaft,
sondern viel zu schnell. Die fortschrittsgierigen, erneuerungs-
wütigen Eliten hätten ganz auf den europäischen Weg in die
Moderne vertraut und damit leichtfertig die Entwicklungs-
chancen für einen eigenen russischen Weg verspielt. Bislang
habe die Forschung das laute industrielle und beschleunigte
Russland in ihrer Interpretation überbetont und dabei die
stille und langsame Zeit nicht genügend beachtet, in der das
Zarenreich noch eingebettet gewesen wäre. Dabei sei außer
Acht geraten, was infolge der Verschärfung des gesellschaft-
lichen Entwicklungstempos seit den „Großen Reformen“
alles auf der Strecke geblieben sei.
96
Diese Interpretation greift die Denkfigur der Slavo-
philen aus dem 19. Jahrhundert auf, die damals schon
meinten, Russlands Zukunft liege nicht in der Gegenwart
Westeuropas, sondern darin, ausgehend von den eigenen
historischen Erfahrungen und gesellschaftlichen Voraus-
setzungen, einen eigenen Weg zu finden, der sich an der
konservativen Dreieinigkeit von Orthodoxie, Autokratie
und Nationalismus orientiere.
97
Von diesem Blickwinkel
95 Eine gute aktuelle Diskussion des Rückständigkeitsparadigmas gibt der
Sammelband von David Feest/Lutz Häfner (Hg.): Die Zukunft der Rück-
ständigkeit. Chancen – Formen – Mehrwert, Köln 2016.
96 Schmidt (wie Anm. 93), S. 193 f.; Neutatz (wie Anm. 38), S. 54 f. u. 87.
97 Bei den Slavophilen handelte es sich um eine politisch-publizistische Be-
wegung, die sich für das „ursprüngliche Russische“ begeisterte und sich
nach 1836 in Auseinandersetzung mit den sogenannten „Westlern“ für
eine Rückbesinnung auf alte slawische Traditionen einsetzte, statt mit
aus Europa übernommenen Modernitätskonzepten dem Zarenreich den
Weg in die Zukunft zu bahnen. Zu dieser ideengeschichtlich bedeutsamen
und folgenreichen Debatte vgl. Jekaterina Lebedewa: Russische Träume.
Die Slawophilen – ein Kulturphänomen, Berlin 2008; Laura Engelstein:
Slavophile Empire. Imperial Russia‘s Illiberal Path, New York 2009.


















