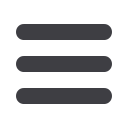
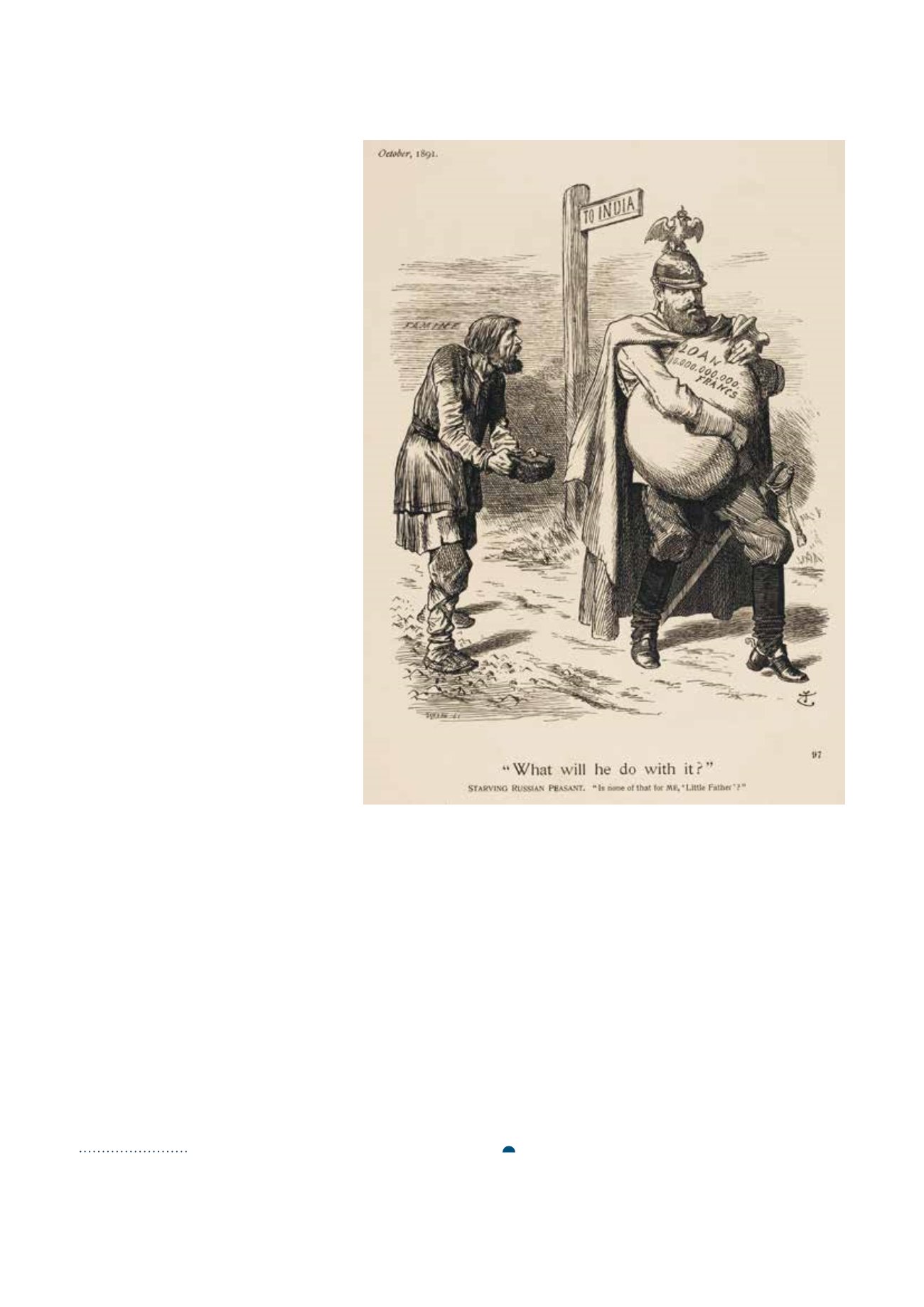
31
Der Russische Revolutionszyklus 1905–1932
Einsichten und Perspektiven 2 | 17
aus erscheint Nikolaj II. nicht als verknö-
cherter Autokrat auf dem Zarenthron,
sondern vielmehr als treuer Gewährs-
mann der russischen Idee. Er hätte das
Zarenreich vor einer fehlgeleiteten Euro-
päisierung retten und als eigenen, vom
Westen klar unterscheidbaren Zivili-
sationstyp ins 20. Jahrhundert führen
wollen. Die liberale Opposition und die
revolutionären Terroristen hätten aber
mit ihren Russland wesensfremden Idea-
len und ihrer konfrontativen Politik dem
Zarenregime den Krieg erklärt, damit die
traditionelle Einheit von Zar und Volk
zerstört und so das Land auf gefährliche
Abwege gebracht. Diese Sicht auf den
letzten Romanov-Zaren und die Zer-
rissenheit des Imperiums hat im heuti-
gen Russland erheblich an Popularität
gewonnen, seit die Russisch-Orthodoxe
Kirche im August 2000 Nikolaj II.
wegen seines Märtyrertods heiliggespro-
chen hat. Die Kanonisierung von histo-
rischen Akteuren schafft Probleme für
diejenigen Historiker in Russland, die
heute gemeinsam mit ihren westlichen
Kollegen weiterhin kritisch über die
Rolle Nikolajs II. nachdenken.
98
In seiner Ansprache an die Föderale
Versammlung im Dezember 2016 zog
der russische Präsident Vladimir Putin
die politische Lehre aus der Revolutions-
geschichte, dass es unter allen Umstän-
den notwendig sei, die Einheit des Lan-
des zu bewahren. Gerade in Zeiten des
gesellschaftlichen Umbruchs bedürfe es eines handlungs-
fähigen starken Staats, um den alles mitreißenden Wandel
nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Demokratisch-
liberale Experimente beschwören in solchen kritischen
Situationen schnell Chaos herauf, weil sie mit ihren For-
derungen nach gesellschaftlicher Emanzipation und poli-
tischer Partizipation die zentrale Staatsgewalt schwächen
oder sogar lähmen würden. Russland könne so erneut
Spielball ausländischer Mächte werden und seine eigentli-
che Bestimmung sowie imperiale Größe verlieren.
99
98 Plamper (wie Anm. 2), S. 292 f.; Kolonickij: (wie Anm. 2), S. 163ff.
99 Zu Putins Rede vgl. Aust (wie Anm. 16), S. 9; Makhotina (wie Anm. 2), S. 297f.
Solche Deutungen zeigen anschaulich, wie der 100. Jah-
restag der Russischen Revolution einen guten Anlass
schafft, um historische Denkfiguren und Erfahrungen für
aktuelle Orientierungs- und Legitimationsbedürfnisse zu
instrumentalisieren. Eine nüchterne problem- und for-
schungsgeschichtliche Erörterung der gewaltigen Umwäl-
zung von 1917, ihren Voraussetzungen und Folgen stellt
darum eine Notwendigkeit dar, damit die heraufbeschwo-
renen Gespenster der Vergangenheit nicht das Geschichts-
bild und Politikverständnis der Gegenwart dominieren,
um mit ihrem Spuk einer
„fake history“
den Weg zu berei-
ten.
Diese Karikatur aus der britischen Zeitschrift „Punch“ kritisiert den Zaren für seine umfangreichen
Finanzinvestitionen im Ausland, während in seinem Reich Armut und Hunger herrschen.
Abbildung: interfoto/Mary Evans


















