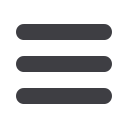

46
den anderen ausreden lassen und ihm genau und respektvoll zuhören.
Versuche nicht, dich spontan zu rechtfertigen oder zu verteidigen. Natürlich kann der andere nie
beschreiben, wie du wirklich bist, aber er kann sehr wohl beschreiben, wie du auf ihn wirkst. Bitte
vermeide Sprüche wie „Du hast ja durchaus Recht in manchen Punkten, aber ...“ oder „Außerdem
solltest du erst einmal vor deiner eigenen Haustüre kehren!“.
wirklich zu verstehen versuchen, was der andere dir sagen will.
Das ist sehr wichtig! Stelle gegebenenfalls Verständnisfragen! Versuche mit Ich-Botschaften und
deinen eigenen Worten das wiederzugeben, was du meinst verstanden zu haben.
Wie kann also ein Feedback-Gespräch ablaufen?
Ein Feedback-Gespräch kann in vier Schritten ablaufen. Hans bittet Anna um eine Rückmeldung zu
seinem Referat. Anna gibt ihm ihre Rückmeldungen in vier Schritten:
1.
Wahrnehmung:
„Ich habe beobachtet, dass ...“
2.
Deutung:
„Ich habe das so verstanden, dass ...“
3.
Empfindung/Gefühl:
„Ich habe das so empfunden, als ...“
4.
Erwünschte Verhaltensänderung:
„Ich wünsche mir, dass ...“
Anschließend bedankt sich Hans bei Anna und nimmt sich etwas Zeit, um die wichtigsten Punkte zu
notieren.
Mit welchen Methoden kann man sich von Gruppen Rückmeldungen einholen?
1. Blitzlicht
Beim Blitzlicht gibt jeder Schüler mit einer kurzen Äußerung Rückmeldung zu einer bestimmten Frage-
stellung. Dazu könnte ein Satzanfang vorgegeben werden, wie z. B. „In dieser Stunde ist mir klar ge-
worden, dass …“ oder „Besonders interessant war für mich …“.
2. Kommentarrunde
Ein Schüler stellt eine Frage zur Einschätzung seiner Kompetenzen oder Fähigkeiten, z. B. „Wie schätzt
ihr meine Teamfähigkeit ein?“. Die Mitschüler geben ihm dazu gezielt Rückmeldung nach den Feed-
back-Regeln. Im Gegensatz zum Blitzlicht ermöglicht diese Methode ausführlichere und differenziertere
Rückmeldungen, dauert aber auch länger.
3. Zielscheibe
Zur Selbst- und Fremdeinschätzung füllen die Schüler eine vorbereitete Zielscheibe aus. Es werden sechs
bis acht Themen, wie z.B. Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit oder Sachkenntnis vorgegeben. Jedem Thema
entspricht bei der Rückmeldung ein Segment der Zielscheibe. In jedem Segment wird ein Kreuz gemacht.
Dabei steht ein Kreuz auf einem weiter außen liegenden Ring für eine positive Einschätzung, eines auf einem
inneren Ring für geringere Zufriedenheit. Auf diese Weise entsteht ein persönliches Profil des Einzelnen.
4. Skalieren
Die Schüler ordnen sich auf einer Skala von 1 bis 10 mit ihrer jeweiligen Einschätzung zu einem vorge-
gebenen Thema ein. Zur Orientierung im Klassenverbund kann die Skala auch am Boden markiert
werden, so dass die unterschiedlichen Standpunkte in der Klasse auch optisch deutlich werden.
5. Stummer Dialog
Zwei bis drei bedeutsame Fragen werden auf Plakaten aufgeschrieben und gut sichtbar aufgehängt.
Die Schüler tragen ihre Antworten auf den Plakaten ein, ohne zu sprechen. Bereits Geschriebenes darf
von anderen nur schriftlich kommentiert werden. Erst nach Abschluss dieser stummen Schreibphase
sind die geschriebenen Antworten im Gespräch zu kommentieren, zu ergänzen, zusammenzufassen
und Folgerungen zu vereinbaren.



















