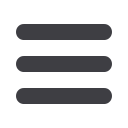

|22|
aviso 2 | 2016
FREMDE, IN DER FREMDE
COLLOQUIUM
Text:
Hermann Unterstöger
In Grimms DeutschemWörterbuch wird das Verb
befremden
mit Hilfe des lateinischen
mirum videri
erklärt, das von
auffallen
bis
wundersam vorkom-
men
alles Mögliche bedeutet. In diesem Sinn könn
te man es befremdend finden, wie unendlich weit
Goethe in seinen Interessen ausgegriffen hat. Un
ter den »Schriften über Literatur« findet sich eine
Abhandlung über serbische Lieder, worin er nach
einemBlick auf das den Völkern eigene »allgemein
Menschliche« sagt: »Das Besonderste aber eines
jeden Volks befremdet nur, es erscheint seltsam,
oft widerwärtig, wie alles Eigentümliche, das wir
noch nicht in einen Begriff auffassen, uns noch
nicht anzueignen gelernt haben.«
Der Satz dürfte bei bestimmten Leuten förmlich
danach schreien, aus demZusammenhang gerissen
zu werden, und zwar dergestalt, dass man daraus
das Argument gewänne, schon »der alte Goethe«
habe andere Völker in ihremKern als befremdlich,
ja widerwärtig eingestuft. Das wiederumwürde die
Verehrer Goethes sehr befremden, und wenn sie,
was bei Goetheverehrern ja öfter mal vorkommt,
auf dem Schlauch stünden, könnten sie auch nicht
das entgegnen, was entgegnet werden müsste: dass
Goethe uns förmlich dazu auffordert, das pri
ma vista Befremdliche zu begreifen und uns so
anzueignen, dass unser Befremden in Freude über
die Bereicherung umschlägt. Integration also, ent
fremden statt befremden.
Exkurs. Da wir schon mal beim alten Goethe hal
ten, sei auch der junge bedacht. Als ihm 1775 die
noch jüngere Lili Schönemann über den Lebens
weg lief, war das ein Herzensereignis, das sich bei
einemwie ihm natürlich alsbald zumGedicht ballte:
be
frem
sprachliche Erkundungen


















