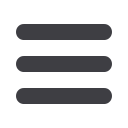

|23 |
aviso 2 | 2016
FREMDE, IN DER FREMDE
COLLOQUIUM
Herz, mein Herz, was soll das geben,
Was bedränget dich so sehr?
Welch ein fremdes neues Leben –
Ich erkenne dich nicht mehr.
Die Romanze kam zu keinem guten
Ende, doch verriet Goethe später dem
getreulich aufmerkenden und imGeiste
mitschreibenden Famulus Eckermann,
dass Lili seine erste große Liebe gewesen
sei. Im Lied nennt er, was ihm da wider
fährt, »ein fremdes neues Leben«, und
wer von uns je an eine wie Lili Schöne
mann geraten ist, erfolgreich oder nicht,
versteht ohne langes Sinnen, was
fremd
in dieser schönen Konstellation bedeu
tet: großartig, wunderbar, umwerfend.
Ende des Exkurses.
Ja, hast du sie noch alle? Diese Frage
müsste jetzt allmählich kommen, und
zwar mit dem Nachsatz, ob denn nun
jedesnochsoabseitigeWortaufdieWaage
der politischen Korrektheit und, imwei
testen Verstande, der moralischen Zu
träglichkeit gelegt werden müsse. Das
Adjektiv
befremdlich
wird üblicherwei
se als gehobenes Synonym für Begriffe
wie
absonderlich, eigenartig, entlegen,
kurios, merkwürdig, sonderlich
oder
ulkig
gehandelt. Sagt jemand, der letzte
Einkommenssteuerbescheid sei ihm be
fremdlich vorgekommen, so denkt sich
sein Gesprächspartner allenfalls, dass
man das auch anders ausdrücken kön
ne, weniger überdreht und spinös. An
eine existenzielle Fremdheit zwischen Steuerpflichtigem und Finanzamt wird er
kaum denken. Das Wurzelwort
fremd
in
befremdlich
hat kaum noch etwas von
dem Stallgeruch, den es ausströmt, wenn der Sänger die »Winterreise« mit den
von Hoffnungslosigkeit umwehtenWorten »Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh
ich wieder aus« beginnt. Es ist in der alltäglichen Rede so flach und leichtgewich
tig wie das Wörtchen
trüb
in
betrüblich
, das wir ja auch für die banalsten Feststel
lungen verwenden: »Betrübliches Wetter heute, nicht wahr?«
Die wenigsten von uns wissen, wie Wörter entstehen, aufwachsen und sich in
der Sprache etablieren. Dafür haben wir die Wissenschaft von der Wortbildung,
der linguistischen Morphologie. Darin spielen Präfixe wie das in unserem Fall zu
besichtigende
be-
eine bedeutende Rolle. Mit diesem kleinen
be-
lässt sich Gro
ßes anstellen, etwa ein intransitives Verb in ein transitives umwandeln:
jammern
wird zu
bejammern
. Liegt so einemKonstrukt ein Substantiv zugrunde, wird also
beispielsweise aus
Glas
das Verb
beglasen
, nennt man das eine Ornativbildung:
Ein Objekt wird mit dem durch das Basissubstantiv Bezeichneten versehen; der
Terminus leitet sich von lateinisch
ornare
gleich
schmücken, versehen mit
her. Auf
befremden
passt das natürlich nicht, weil da ja niemand mit Fremde versehen
wird. Man kann aber einen Fall vom Typ
befreien
gleich
frei machen
mitlaufen las
sen und in sehr lockerer Assoziation sagen, dass in
befremden
etwas wie
seltsame
Gefühle erwecken
stecken könnte.
Seltsame Gefühle wohlgemerkt! Wir müssen uns hüten, dass wir vor lauter Orna
tivbegeisterung das leicht Unheimliche in
befremden
unter den Teppich kehren.
Die Verlockung ist groß, da bei der Erwähnung von Gefühlen im Hintergrund
sofort Beethovens sechste Symphonie aufrauscht, deren erstem Satz der Meister
das Motto »Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande«
mit auf den Weg gegeben hat. Wir wollen das festhalten: Es waren heitere Gefüh
le, nicht seltsame, und wahrscheinlich ist das auch der Grund, dass wir von dieser
Symphonie alles andere als befremdet sind.
den
Hermann Unterstöger
schreibt seit 1978 für die Süddeutsche Zeitung.
Schwerpunkte seiner Arbeit sind Reportagen für die Seite 3, zahlreiche Streif-
lichter und die Kolumne »Sprachlabor«, die sich der Sprache, vornehmlich
der Zeitungssprache, widmet. 2010 erhielt er den Ernst-Hoferichter-Preis der
Stadt München. In der Begründung hieß es: »Unterstögers Texte sind eine
Form für sich, irgendetwas Drittes zwischen Journalismus und Kunst.«


















