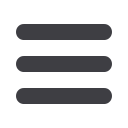

|26|
aviso 2 | 2016
FREMDE, IN DER FREMDE
COLLOQUIUM
MIGRATION, OB ERZWUNGEN
oder freiwillig, ob voller Verzweif
lung oder voller Hoffnung, enthielt durch alle Zeiten Phasen
hoher Irritation, großer Unsicherheit und Angst. Denn zwi
schen dem Verlassen der vertrauten Umgebung, der Fami
lie, der Freunde, und der sicheren Ankunft an einemOrt, an
dem man bleiben wird, liegt ein Raum großer Gefährdung.
Es geht um Abschied und Grenzüberschreitung, um den oft
schwierigen Weg durch das Unbekannte zu einem fernen
und unklaren Ziel.
Vor diesem Hintergrund lassen sich Verbindungslinien zwi
schen ganz unterschiedlichen Formen von Flucht, Emigra
tion oder Vertreibung ziehen, dies vor allem dann, wenn es
um die Perspektiven, die Ängste und Hoffnungen der Betrof
fenen geht. Denn mit der Angst der Migranten und Migran
tinnen korrespondiert die Angst der Menschen in den Ziel
ländern – Angst vor »Überfremdung«, vor Konkurrenz auf
dem Arbeitsmarkt, vor einem Verlust von Besitz und Privi
legien. Die »Fremden« will man nicht, man fürchtet sie und
lehnt sie deshalb ab. Diese Ablehnung ist nicht erst heute mit
Aussperrung und Ausgrenzung verbunden. Viele der großen
Zwangsmigrationen des 20. und 21. Jahrhunderts waren be
gleitet von Grenzschließungen und Internierungen »feindli
cher Ausländer«, von Arbeitsverboten und Diskriminierungen.
DIE BEIDEN KORRESPONDIERENDEN
Ängste, die der Ankom
menden und die der Mitglieder der Aufnahmegesellschaft, gin
gen und gehen eine unselige Verbindung ein: Die Ankommen
den spüren die Ablehnung und dies steigert ihre Verzweiflung
und Not. Und den Einheimischen versperrt die Angst vielfach
den Blick auf die Qualitäten und Angebote der Ankommenden.
Vor demHintergrund der Angst lernt man sich nicht kennen,
sondern hält sich fern und lebt lieber mit Stereotypen weiter,
die es erlauben, die eigenen Vorurteile aufrecht zu erhalten.
Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland
Sieht man unter diesem Blickwinkel auf die drei Zeitschnit
te 1938-1945-2016, so lässt sich dies leider gut belegen. Die
von den Nazis rassistisch verfolgtenMenschen, die 1938 noch
nicht aus Deutschland emigriert waren, erlebten im eigenen
Land, aber auch von außen, die Ablehnung vieler Länder der
Welt. Ohne persönliche Bürgschaften aus dem Aufnahme
land gab es kein Visum. Und ohne Visum keine Schiffspas
sage. Die jüdischen Kinder, in der heutigen Diktion wären
das »unbegleitete minderjährige Flüchtlinge«, die in England
im Rahmen des Kindertransports aufgenommen wurden,
erlebten den Abschied von den Eltern oft als dramatisch und
endgültig. Die zurückbleibenden Eltern schickten ihre Kin
der ins Leben und mussten befürchten, sie nie wieder zu
sehen; die Kinder wiederum fühlten sich oft wie verstoßen.
Ohne dieses englische Angebot, 10.000 jüdische Kinder unter
17 Jahren aufzunehmen, wären aber wohl auch diese Kinder
in der Shoah ermordet worden wie ein Großteil ihrer Eltern.
Es hatten sich die Quäker und die jüdischen Gemeinden nach
den Novemberpogromen 1938 an die englische Regierung
gewandt, um diese Ausnahmeregelung von den strengen
Einreisebedingungen zu erreichen, die Gemeinden bürgten
mit 50 Pfund (heute wären das etwa 1500
€
) für jedes Kind.
DAS AUFNAHMELAND ENGLAND
internierte nach demEintritt
in den Krieg 1939 Emigranten, darunter auch etliche der Kin
der, als »enemy aliens« z. B. auf der Isle of Man. Die gerade
glücklich Entronnenen waren wieder mit Stacheldraht und
Bewachung konfrontiert und sahen angstvoll einer unsicheren
Zukunft entgegen. Auch nach Auflösung der Internierungsla
ger schlugen sich Emigranten unter schlechtesten Lebensbe
dingungen durch. Manche Schiffe wurden auch von Hafen zu
Hafen weitergeschickt, bevor die Emigrierten irgendwo viel
leicht doch an Land gehen durften. Auf der Flucht oder in un
wirtlichen Fluchtorten war die Angst ständiger Wegbegleiter.
Hochangesehene und international begehrte Wissenschaftler
oder herausragende Schriftsteller wie Thomas Mann hatten
bessere Bedingungen der Aufnahme. Insgesamt jedoch war
für die meisten Emigrierten der Abschied von Deutschland
der Beginn einer langen, oft lebenslangen Strecke der Hei
matlosigkeit und des sozialen Abstiegs.
Die Ängste von Vertriebenen und
Einheimischen nach 1945
1945 begann im zerstörten und besetzten Deutschland ein
neues Kapitel der Migrationsgeschichte: Zunächst suchten
diejenigen Schutz, die vor der vorrückenden Roten Armee
flohen, dann immer mehr Menschen, die nach den Bestim
mungen des Potsdamer Protokolls aus den deutschen Ostge
bieten oder aus Ostmitteleuropa ausgewiesen worden waren.
Allein nach Bayern kamen etwa zwei Millionen Menschen;
kleine Landgemeinden wuchsen oft um mehr das Doppelte
an. Hier eine Momentaufnahme aus dem Jahr 1946: Für das
kleine Dorf Pöcking bedeutete dies, dass 555 Einwohnern über
18 im Kerndorf 489 Zugezogene gegenüberstanden.
DIE FLÜCHTLINGE UND
Vertriebenen, darunter sehr viele Frauen
und Kinder, hatten oft dramatische und traumatische Flucht
erlebnisse hinter sich. Oft sahen sie sich dennoch nach der
Ankunft mit hartherziger Ablehnung konfrontiert. Vielfach
ist in Erzählungen die Rede von zutiefst kränkenden Zu
rückweisungen, von der Verzweiflung einer Familie, die mit
der wenigen geretteten Habe von Tür zu Tür oder gar von
Ort zu Ort zieht, ohne aufgenommen zu werden. Es ist die
Geschichte des Heimatverlustes sowie der verstörten und
verstörenden Ankunft in der Fremde. In anderen Erinne
rungen tauchen dann auch freundliche Helfer, »Paten« im
neuen Lebensabschnitt auf, die sich der Hilflosen erbarmen,
die ein Herz haben und Wärme und Essen teilen. Auch von
heimlich zugesteckten Lebensmitteln, von Nachbarschafts
hilfe beim Hausbau ist zu lesen. Es waren wohl beide Seiten
zu finden und die Erinnerung betont teils die einen, teils die
anderen Bilder.
Text:
Marita Krauss
Fotos: picture alliance / dpa/ Armin Weigel © IMAGNO, Sudetendeutsches Archiv München, Inv-Nr. 4496, © dpa


















