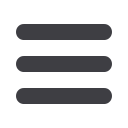
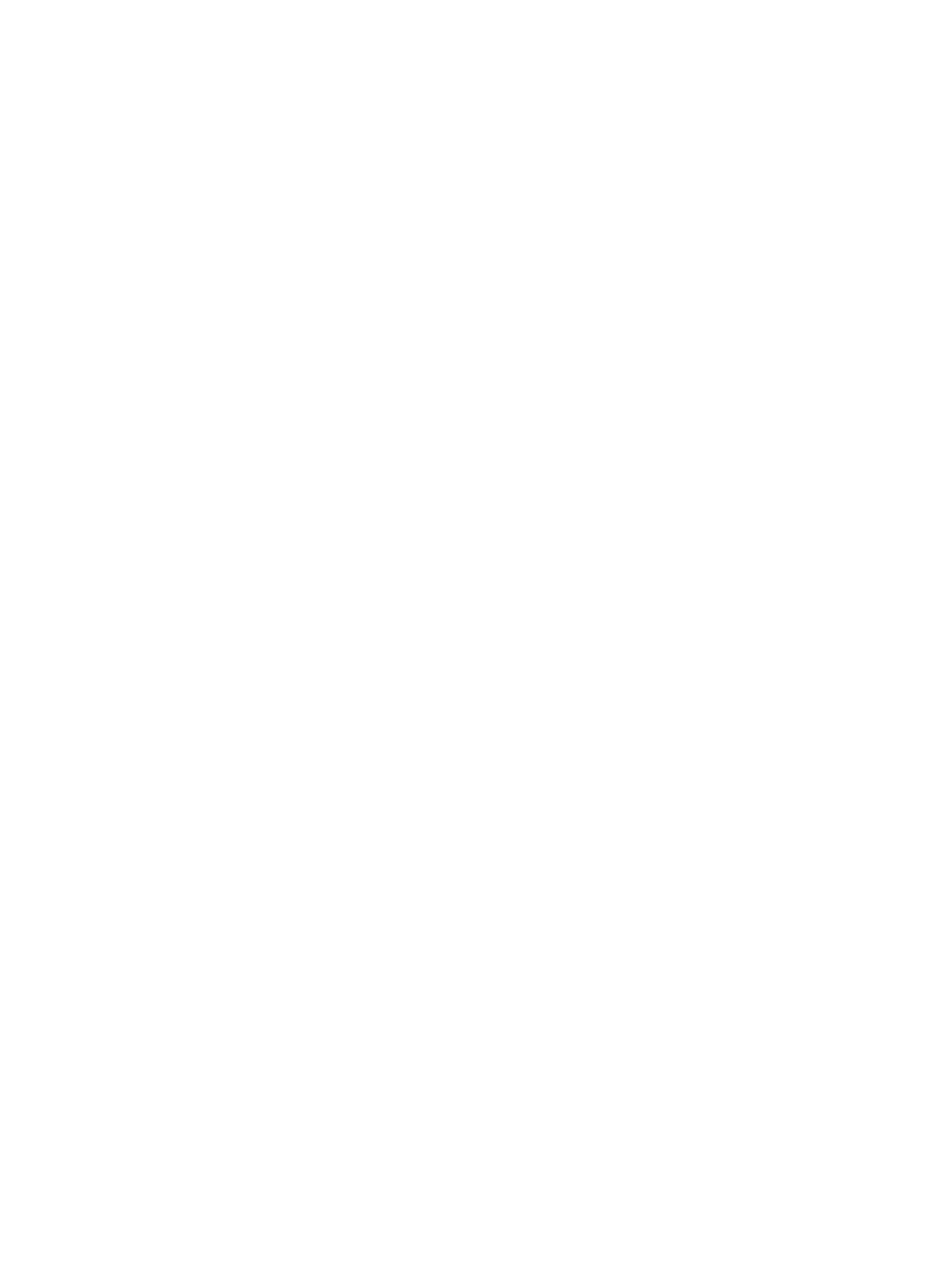
|27 |
aviso 2 | 2016
FREMDE, IN DER FREMDE
COLLOQUIUM
DIE EINHEIMISCHEN SAHEN
die Ankömmlinge oft als Eindring
linge an. Es gab Bauern, die den Boden eines unbewohnten
Zimmers in ihrem Hof herausrissen, nur um keine Einquar
tierung zu bekommen, sie lehnten es ab, die Küche oder gar
Essen mit den Zugewiesenen zu teilen, es kursierten bittere
Flüchtlingswitze und Spottnamen. Immer wieder wurde die
Angst formuliert, die Angst um die eigene Identität, um Be
sitz und Verfügungsmacht, um Einfluss und Privilegien. Zu
nächst erschienen die Vertriebenen meist als »die Fremden«.
Der Fremde, der Flüchtling, bot sich als Projektionsfläche für
die eigenen Ängste an, sie galten als »Habenichtse« und »Feld
diebe«, als »Horden«, die Restdeutschland »überschwemm
ten«. Diese »Flut- und Deichgraf-Metaphorik« ist bis heute
üblich, um Migrationen als Naturkatastrophen erscheinen
zu lassen.
Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieb der Soziologe
Georg Simmel den Fremden als »Provokateur«: In seinem
Anderssein provozierend gegenwärtig hat er die Gelöstheit des
Kommens und Gehens noch nicht abgelegt und demonstriert
den Einheimischen, dass die Welt, in der sie leben, keines
wegs begründungslos selbstverständlich ist. Um ihre Identi
tät nicht zu verlieren, müssen sie sich neu definieren, indem
sie sich von ihm abgrenzen; dies erleichtert der »Provoka
teur« meist dadurch, dass er eine ganze Zeit am Wertesys
tem seiner Heimat festhält. Dies löst Angst aus, so Simmel:
»Angst kommt auf, wenn Grenzen überschritten werden
müssen und wir von etwas Gewohntem, Vertrautem uns zu
lösen und uns in Neues, Unvertrautes zu wagen haben. Der
Fremde ist dabei wesentlich der Mensch, der fast alles, das
den Mitgliedern der Gruppe, der er sich nähert, unfraglich
erscheint, in Frage stellt.«
IM KONKRETEN FALL
der Vertriebenenintegration nach 1945
kam es letztlich zu einem guten Ende: Je mehr sich die Neu
bürger als »tüchtig« erwiesen, als gute Facharbeiter, die zum
wirtschaftlichenWiederaufbau des zerstörten Landes beitru
gen, desto leichter wurden sie akzeptiert. Es wurde dann eben
doch eine privilegierte Eingliederung: Es halfen die gleiche
Sprache, die gemeinsame Religion – obwohl es Protestanten
im katholischen Altbayern und Katholiken in Franken auch
nicht gut erging –, es half der Bezug auf eine gemeinsame
deutsche Kulturnation. Heute sagt ein Bauer aus Oberbay
ern: »Ich weiß nicht, was die heut haben – damals sind es
viel mehr gewesen und des haben wir auch geschafft.« Die
Angst wurde durch Erfahrung besiegt.
Migration – der Normalfall
Und damit sind wir im Jahr 2016 und bei der aktuellen Flücht
lingssituation: Wieder kommen Menschen mit dem Nötigs
ten, mit traumatischen Fluchterfahrungen, voller Ängste
und Hoffnungen in das inzwischen reiche Deutschland. Die
Angst begleitete sie über das Meer, in den Schlauchbooten und
seeuntüchtigen Schiffen, gegenüber den Schleusern, auf der
Professorin Dr. Marita Krauss
vertritt in der Universität
Augsburg den Lehrstuhl für Europäische Regionalgeschichte
sowie Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte.
Zu ihren wichtigsten Forschungsthemen gehören Migration und
Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen, die Geschichte
von Emigration und Remigration, aber auch bürgerliche
Wirtschaftseliten in Bayern sowie Herrschaftspraxis in Bayern
und Preußen.
Dieser Text geht zurück auf einen Vortrag im Haus des
Deutschen Ostens in München zum Themenschwerpunkt des
Jahres 2016 »Integration und Identität gestern und heute«.
Weitere Veranstaltungen unter
hdo.bayern.deZum Weiterlesen
Marita Krauss, Sarah Scholl-Schneider, Peter Fassl (Hg.),
Erinnerungskultur und Lebensläufe. Vertriebene zwischen
Bayern und Böhmen im 20. Jahrhundert – grenzüber-
schreitende Perspektiven. Volk Verlag München 2013.
Balkanroute an Zäunen und Grenzen. Die Macht der Bilder
ist bei dieser Migration überwältigend: Massen und Müll,
Menschen in überfüllten Zügen, wandernde Menschenmen
gen auf Feldwegen, Bahnlinien und Autobahnen. Und wieder
greifen die Mechanismen, die bereits beschrieben wurden:
Hasserfüllte Demonstranten am Zaun von Flüchtlingscamps,
auf deutschen Straßen und Plätzen, Deichgrafmetaphorik
und Endzeitszenarien, unsägliche Kampagnen in den sozia
len Medien. Wieder fürchten wir alle um Wohlstand und
Privilegien, wieder stellen sich Fragen von Identität, Besitz
und Verfügungsmacht.
NIEMAND KANN SAGEN,
wie diese heutige Herausforderung
bewältigt werden kann. Aber es lassen sich doch Erfahrun
gen aus der Geschichte heranziehen: Es gibt gute Chancen,
dass auch diese Migration letztlich nicht zum Kollaps führt.
Wieso sollte sie, wenn auch im zerstörten Deutschland nach
1945 kein Bürgerkrieg ausbrach, als in Deutschland zwölf
und davon in Bayern zwei Millionen aufzunehmen waren?
Wieso sollte sie bei einer prosperierenden Wirtschaft und
geringer Arbeitslosigkeit, bei einer Wirtschaft, die in Zukunft
auf junge Leute angewiesen sein wird? Vergleichen wir noch
einmal die Zahlen: In Pöcking standen 1946 555 Einwohnern
über 18 imKerndorf 489 Zugezogene gegenüber; heute sind
es bei 4212 Einwohnern im Kernort Pöcking 141 Asylbewer
ber bzw. Flüchtlinge. Und das soll nicht zu schaffen sein?
Der Blick in die Geschichte zeigt, dass Migration die Norma
lität, nicht der Ausnahmefall war. Immer wieder machten
sich die Menschen auf den Weg, um im fremden Land neue
Chancen zu finden – nach dem 30-jährigen Krieg wurden
z. B. das Allgäu von Tirol aus und Franken von Böhmen aus
fast neu bevölkert, im 19. Jahrhundert brachen die Euro
päer inMillionenzahl nach Amerika auf, im 20. Jahrhundert
holte man immer mehr Arbeitskräfte ins Land, die heute einen
nicht mehr wegzudenkenden Teil der deutschen Bevölkerung
darstellen. Auch Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber
kennen wir seit vielen Jahren. Immer wieder kam die Angst
auf, das sei nicht zu bewältigen – und immer wieder lehrte
die Erfahrung, dass es anders war. Wir können nicht in die
Zukunft sehen. Doch es ist Optimismus gefragt, nicht die
Angst.


















