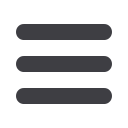
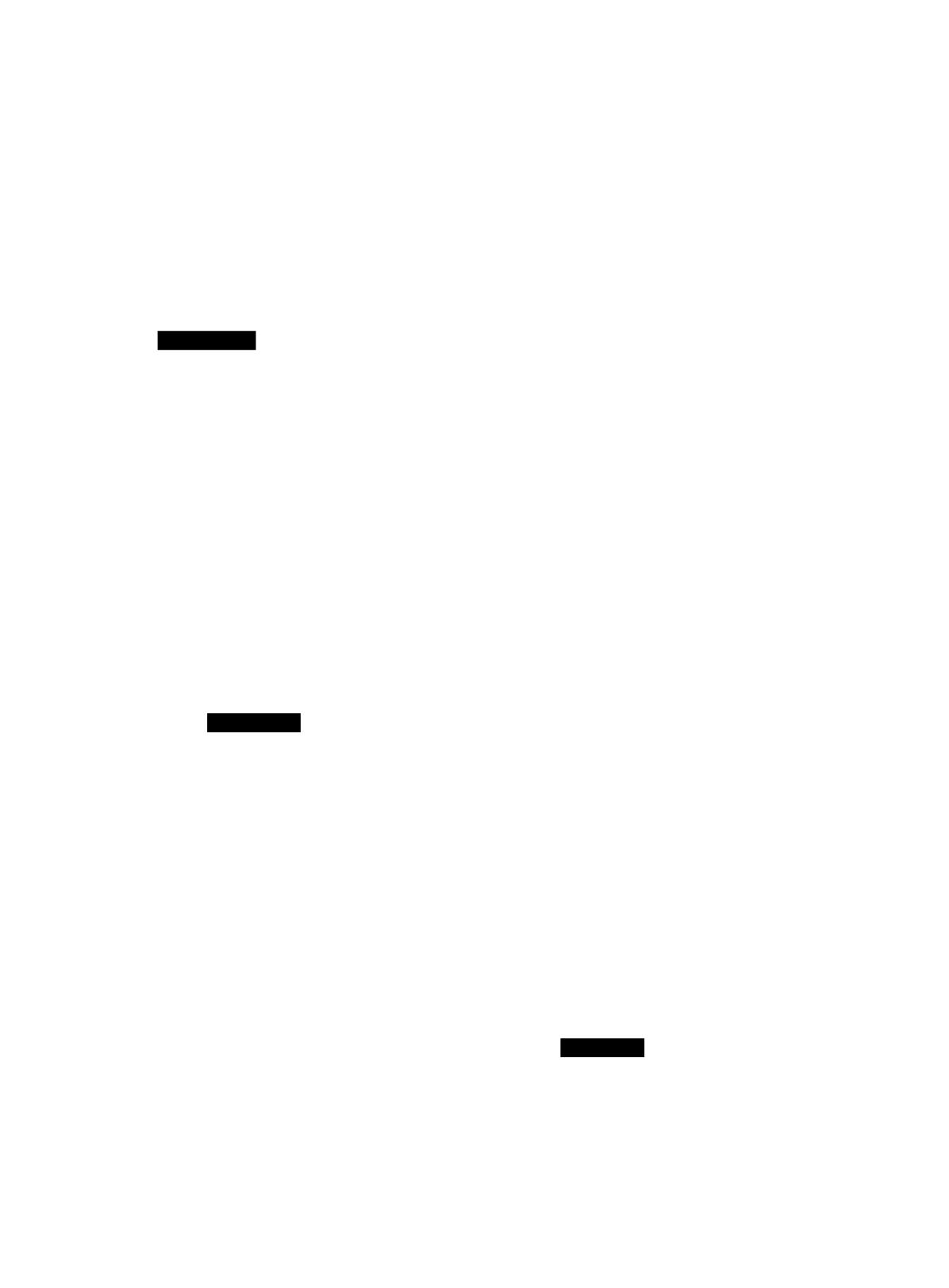
|29 |
aviso 2 | 2016
FREMDE, IN DER FREMDE
COLLOQUIUM
»Flüchten Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu
wohnen«, war Ende Januar zynisch auf Schildern
am Ortseingang von Sondershausen im Norden Thü
ringens zu lesen. Der Elan der deutschenWillkommens
kultureuphorie ist verpufft. Hassreden im Internet und bei
öffentlichen Veranstaltungen heizen die geladene Stimmung
weiter auf. Morddrohungen per Postkarte trieben den Zorne
dinger Pfarrer Olivier Ndjimbi-Tshiende, einen gebürtigen
Kongolesen, zum Rücktritt. Der Wortlaut: »Ab mit dir nach
Auschwitz« und »Nach der Vorabendmesse bist du fällig«.
Brandreden.
Hate Speech.
Allein in den ersten sechs Wochen des jungen Jahres 2016 wur
den laut Angaben des Bundesinnenministeriums 118 Über
griffe gegen Asylunterkünfte, darunter 17 Brandstiftungen
und 27 Gewaltdelikte, verübt. 2015 waren es bereits 1029
Straftaten. Seit 1989/90 zählte die Amadeu-Antonio-Stiftung
187 Morde aus rassistischen oder rechtsextremistischenMoti
ven. Jüngste Umfragen haben gezeigt, dass ein Viertel der
Deutschen ›fremdenfeindlichen‹ Aussagen zustimmt und dass
16% finden, dass »weiße Menschen die Welt regieren sollten«.
Den Soundtrack liefert hasserfüllte Sprache, sog.
Hate Speech
,
besonders im Internet – in den Kommentarfunktionen der
Zeitungen, in Auseinandersetzungen in den Social Media
und auf öffentlichen Veranstaltungen. Diese von Drohungen,
Beleidigungen, Häme und Hetze geprägte Sprache erfüllt teil
weise den Tatbestand der Volksverhetzung, kommt oftmals
aber auch subtiler daher.
Etikettenschwindel.
Schönreden.
Der Begriff »Fremdenfeindlichkeit« oder auch »Xenophobie«,
vormals auch »Ausländerfeindlichkeit«, findet noch immer
in der Kriminalberichterstattung, in Teilen der Sozialwissen
schaften und der politischen Debatte Verwendung. Von der
Kritischen Rassismusforschung wird er aber mit Vorbehalt
betrachtet: Es sind meist eben keine ›Fremden‹, die Opfer von
rassistischer Gewalt und Diskriminierung werden. Die Op
fer der NSU-Morde waren ja keine Fremden, sondern lebten
langjährig in deutschen Städten, darunter auch München und
Nürnberg, als ansässige Geschäftsleute, Nachbarn, Steuer
zahler. Der in diesem Zusammenhang entstandene Euphe
mismus »Döner-Morde« machte eine recht steile und breite
mediale Karriere im deutschsprachigen Raum, ehe er dann
zum Unwort des Jahres 2012 gekürt wurde und endlich ver
schwand. In der Jurybegründung des Negativpreises heißt es:
»Mit der sachlich unangemessenen, folkloristisch-stereotypen
Etikettierung einer rechtsterroristischen Mordserie werden
ganze Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt und die Opfer selbst
in höchstem Maße diskriminiert, indem sie aufgrund ihrer
Herkunft auf ein Imbissgericht reduziert werden.« Auch
Afrodeutsche wie auch andere deutsche PoC (Persons of Co
lor) sind keine Fremden, werden aber allzu oft so markiert:
Das beginnt im Alltag mit scheinbar harmlosen Erkundi
gungen wie »Wo kommen Sie denn URSPRÜNGLICH her?«
oder Bewertungen: »Sie sprechen aber gut Deutsch«. Sie
werden im Racial Profiling diskriminiert. Wenn sie sich in
für nicht-weiße Menschen gefährliche Stadtviertel oder
Regionen trauen oder eben dort leben, nützt es ihnen na
türlich nichts, wenn sie im Falle eines Angriffs noch schnell
ihren deutschen Pass zücken oder die Nationalhymne an
stimmen.
An den willkürlichen Konstruktionsprozessen von vermeint
lich ›Fremden‹ oder ›Anderen‹, dem »Othering«, sind wis
senschaftliche, mediale, politische und andere Akteure der
Gesellschaft mittels Sprache, gepaart mit Macht, beteiligt.
Fremde gehören ja per Definition nicht zur eigenen Gesell
schaft, haben von daher kein wirkliches Anrecht auf kulturelle
oder materielle Ressourcen – da kommt dann natürlich und
selbstverständlich Fremdenfeindlichkeit auf, flüstert die krude
Logik des Begriffs. Der synonyme Begriff der Xenophobie lie
fert eine quasi kausale naturgegebene Erklärung für Gewalt
und Ausgrenzung. Eine Phobie ist eine spontane, unkontrol
lierbare Angststörung, sie lässt sich nicht wegdiskutieren, der/
die Phobiker*in steht quasi nicht in der Verantwortung. Mit
beiden Begriffen – »Fremdenfeindlichkeit« wie auch »Xeno
phobie« – wird so eine Art Steilvorlage geliefert, die noch dazu
die Täterperspektive einnimmt.
Die vermeintlich ›fremdenfeindliche‹ Tat wird aber nicht ver
übt, weil das Opfer eine bestimmte Eigenschaft oder Herkunft
hat, sondern weil der Täter oder die Täterin eine bestimmte
Einstellung hat. In der öffentlichen Kommunikation, insbe
sondere den Medien, wird der Begriff fast immer dann ver
wendet, wenn es eigentlich um rassistisch motivierte Straftaten
geht. Wenn also ein Mensch oder eine Menschengruppe als
biologisch, religiös, kulturell oder sozial »anders« und »gleich
zeitig minderwertig« konstruiert wird, während Weißsein
und Christentum als meist unausgesprochene Markierer der
Norm fungieren. So wird schön(er) geredet, was nicht schön
zu reden ist. Auch wenn Menschen in Deutschland aus der
weißen Mehrheitsgesellschaft heraus mit dem ›Migrations
hintergrund‹ versehen werden, ist damit selten ihre Staats
bürgerschaft oder die Herkunft ihrer Eltern gemeint. Denn
die Kinder weißer Schweizer*innen, Norweger*innen oder
Amerikaner*innen werden im landläufigen Sprachgebrauch
nicht derart bezeichnet. Gemeint sind damit gewöhnlich vom
Weißsein abweichender Phänotypen und/oder vom Christen
tum divergierende Religionen, derzeit insbesondere der Islam.
Machtworte.
Wortmacht.
Worte schaffen Zustände. Sprache als menschengemachter
Schauplatz von Artikulation beeinflusst Weltwahrnehmung
und Verhalten und strukturiert die Handlungsweisen von
Individuen, Gruppen oder Institutionen. Machtausübung
ist bedingt durch Sprache und Sprache konstituiert Macht.


















