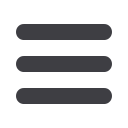
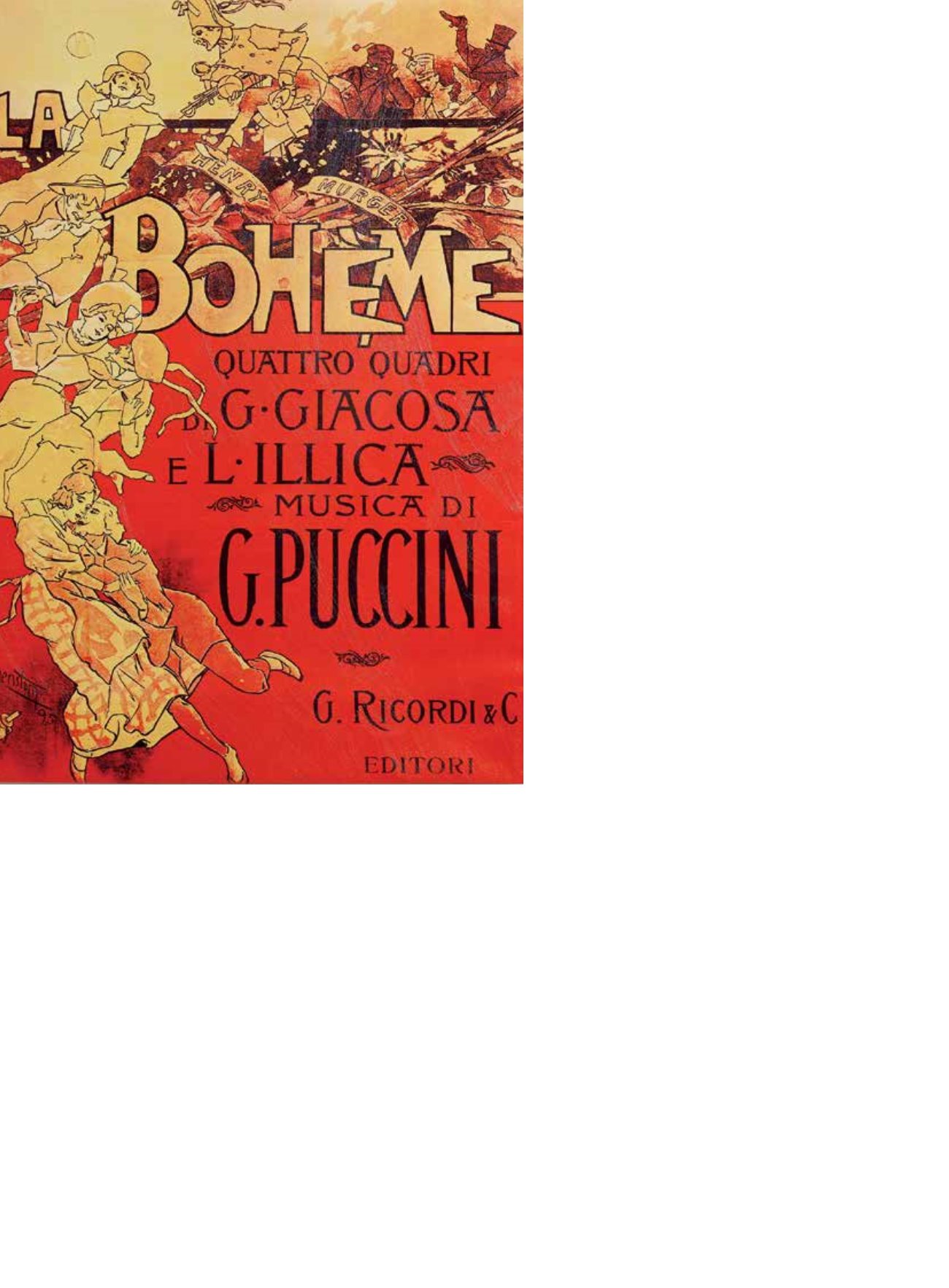
|33 |
Nationale Konvertierung
Lange war es nicht mehr präsent gewesen, wie sehr geradeMünchen zwi
schen 1850 und 1914 als mitteleuropäische Metropole der Kunst glänzte,
die viele Studenten aus dem Ausland anzog. Erst 1990 wurde durch
Wolfgang Kehrs wegweisende Publikation München als »Kreuzpunkt
europäischer Kultur« wieder ins Bewusstsein gehoben, was dann 2008
anlässlich der Jubiläumsausstellung der Akademie im Haus der Kunst
als europäisches Panorama der Malerei eindrucksvoll die Räume füllte:
Ein Europa vor Europa.
Wie es für
die kulturellen Bildungsmigranten des 19. Jahrhunderts typisch
war, gingen sie nach dem Ende der Ausbildung in ihre Herkunftsländer
zurück, wo viele der Heimkehrer nun das inMünchen erlernte Idiomdes
Klassizismus auf ihrenHeimatmärkten zur Formulierung nationaler Iden
titäten einsetzten: die Kunstsprache Europas wurde in die kleinerenMün
zen eines rapide erstarkenden Nationalismus konvertiert, um nationale
Mythen bildhaft werden zu lassen oder überhaupt erst zu konstruieren.
Diese Krise des europäischen Selbstverständnisses
stand imZentrumder Forschungsarbeit zahlreicher
Wissenschaftler und Kuratoren aus ganz Europa, die
für das Akademiejubiläum 2008 den Spuren ihrer
Nationalkünstler des 19. Jahrhunderts nachgingen
und ein durch viele Ereignisse, auch des 20. Jahr
hunderts, verschüttetes Europa der Kunst wieder
aufleben ließen.
Bohème als Utopie
Bald nach der nationalen Konvertierung des europä
ischen Klassizismus sollte er als Akademismus zum
Feindbild einer modernistischen Bewegung werden,
die – von Paris, München und Berlin ausgehend –
ebenfalls wieder europaweit ausstrahlte, wenn auch
nicht mehr vornehmlich über die Akademien, son
dern über einen rapide gewachsenen bürgerlichen
Kunstmarkt, der eines seiner wichtigsten Zentren
im Münchner Glaspalast besaß. Nun entstand ein
anderes, neues Europa der Kunst, nämlich eines der
Avantgarden, wofür gerade der Münchner Blaue Rei
ter ein Musterbeispiel war, der russische, deutsche,
spanische und französische Künstler sowie solche aus
der Schweiz und Österreich zusammentrommelte.
Dieser Internationalismus kam
aus einemneuenMilieu,
das an den europäischenWegkreuzungen der Kunst
welt des 19. Jahrhunderts entstanden war und schon
das Fin de siècle geprägt hatte: die Bohème. Als
innerstädtische Randexistenz hatte diese sich schon
im 19. Jahrhundert durch unkonventionelle Haar
tracht und demonstrativ abweichende Kleidung
bemerkbar gemacht. Es war diese Tracht einer
stolz improvisierenden Armut, die demMilieu den
Namen einbrachte, der in Frankreich ursprüng
lich für die exotische Erscheinung aus Böhmen und
anderen Gegenden zugewanderter »Zigeuner« ge
prägt worden war.
Nun wurde er für ein bunt gemischtes Soziotop
adaptiert, das aus Schauspielern, Schriftstellern,
Musikern, Tänzern, Malern und Bildhauern be
stand sowie aus ihren publizistischen Parteigängern,
Sammlern und anderen Dandys. Schon zum Jahr
hundertende war es durch das Libretto von Puccinis
gleichnamiger Oper romantisiert worden, als eines
der Armut vielversprechender Talente imAufbruch
der Künste zur Moderne.
Vielleicht hat es
in Europa nie ein so integrationsfreu
diges Milieu gegeben wie das der Bohème, wo das
Bekenntnis zur Moderne und die Gegnerschaft zur
Bourgeoisie jeden Pass ersetzten. Unter demDruck
aviso 2 | 2016
FREMDE, IN DER FREMDE
COLLOQUIUM
Abbildung: Gemeinfrei
links
Plakatentwurf von Adolfo Hohenstein für die Oper »La
Bohème« von Giacomo Puccini, 1895.


















