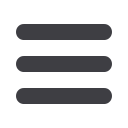

|30|
aviso 2 | 2016
FREMDE, IN DER FREMDE
COLLOQUIUM
Fremdheit ist ein soziales Konstrukt durch die Mehrheit. Bei
Inklusion wie Exklusion von Menschen spielt Sprache eine
aktive und tragende Rolle.
Dass es innerhalb einer Sprachgemeinschaft also unterschied
liche Meinungen darüber gibt, ob ein bestimmter Ausdruck als
diffamierend, rassistisch oder als Hassrede gelten sollte oder
nicht, ist nicht weiter verwunderlich. Mitglieder einer privile
gierten Gruppe empfinden einen sprachlichen Ausdruck häufig
deshalb nicht als herabwürdigend oder verunglimpfend, weil
er sich nicht gegen sie, sondern eben gegen eine – von ihrer
postulierten Normwarte aus gesehen – abweichende Gruppe
richtet. Die eigene Prägung wird nicht als solche und somit
subjektiv benannt, sondern als objektiv verklärt und führt
gepaart mit demmangelnden Bewusstsein der eigenen Privile
giertheit zum blinden Fleck hinsichtlich anderer Lebens- und
Erfahrungswelten und damit zur Empathielosigkeit.
Die Begriffe, Metaphern und Konzepte, mit denen wir selbst
verständlich hantieren, prägen unser Bild von der politisch-so
zialenWirklichkeit. Wenn die schwarze Kulturwissenschaftle
rin bell hooks von »Sprache als umkämpftemTerrain« spricht,
fragt sie damit auch: Wer hat »das Sagen« und wer findet
»kein Gehör«? Wer hat die Deutungsmacht über Sprache und
wer wird bei Protest meist belächelt oder ignoriert? Wessen
Sprache findet in welchen Foren, Medien, Kanälen Gehör?
Wer wird wie von wem benannt? Und wer wird sprachlich
ausgeschlossen? Wessen und welche Sprache schafft es in
die Wörterbücher, Kinderbücher, Schulbücher, Leitmedien?
Gerade Medien spielen bei der Konstruktion des ›Anderen‹
oder des ›Fremden‹ eine bewusstseinsbildende Schlüsselrolle.
Was durch diesen Filter passiert, verrät also nicht nur vieles
über den in die Welt gerichteten Blick, sondern insbesondere
Aussagekräftiges über das Selbstbild, denn letzteres wird, wie
vom britischen Kulturwissenschaftler Stuart Hall theoretisiert,
meist via direkten Umweg über das Fremdbild erstellt: »Die
Engländer sind nicht deshalb rassistisch, weil sie die Schwar
zen hassen, sondern weil sie ohne die Schwarzen nicht wis
sen, wer sie sind.«
Hierbei ist noch eine weitere Dimension von Sprache relevant:
Sprache fungiert als historisches Archiv. Sie tradiert gewisse
kulturgeschichtliche Konzepte und Vorstellungen, die imWer
degang der jeweiligen Wortschöpfung machtvoll waren. Der
Mainzer Germanist Rainer Kohlmayer dazu: »In der deutschen
Sprache gibt es wie in jeder anderen zahlreiche Spuren ural
ter Gewaltverhältnisse. Zum Beispiel der Knechtungszusam
menhang von ›hören‹, ›horchen‹, ›gehören‹, ›gehorchen‹. Man
muss sich gegen das raffinierte Geraune der Vatersprache zur
Wehr setzen.« Das sollte uns natürlich nicht vom (empathi
schen) Zuhören abhalten, aber eben vom (blinden) Gehorsam.
Gleichzeitig ist dieses Spracharchiv aber auch lebendig und
dynamisch wandelbar. Und somit umkämpft: Sprache ist vie
len Menschen eine Heimat. Sie sollte schon deshalb so inklu
siv wie möglich sein.
Tödliche
Metaphern.
Der US-amerikanische Linguist George Lakoff analysiert
die Metaphern, die Politiker*innen in öffentlichen Debatten
benutzen, um die öffentliche Sicht auf politische Verhältnisse
zu steuern. Wortschöpfungen wie die »Achse des Bösen« oder
der »Krieg gegen den Terror« strukturieren laut Lakoff tiefgrei
fend unser Denken und Handeln. Metaphern könnten töten,
behauptete er deshalb 1990 in seinem Text »Metapher und
Krieg«, dessen Kernidee er dann jeweils im 10-Jahres-Intervall
auf ’s Neue anhand der jeweils aktuellen amerikanischen Geo
politik überprüfte. Rezipient*innen nähmen Politiker-Meta
phern-Assemblagen derart ernst, und eben wortwörtlich, dass
es allein aufgrund metaphorischer Wortschöpfungen möglich
sei, die Bevölkerung beispielsweise von der Notwendigkeit zu
überzeugen, Kriege anzuzetteln und dabei Zehntausende von
zivilen Opfern in Kauf zu nehmen. Die zentrale metaphori
sche Aussage des Zweiten Golfkriegs »Saddam ist ein Ty
rann. Er muss gestoppt werden!« etwa verschleierte, dass die
3000 Bomben, die allein in den ersten beiden Kriegstagen den
Irak trafen, nicht nur auf diese eine Person zielten, sondern
viele Tausende töteten und verletzten. Mittels der Metapher
waren sie unsichtbar gemacht worden. Die Metapher sug
gerierte, dass der Krieg nur gegen Saddam Hussein geführt
wurde, nicht gegen das irakische Volk.
Ein Experiment an der Universität Stanford aus dem Jahr
2012 belegt die Lakoff ’schen Thesen eindrucksvoll. Die
Psycholog*innen Paul Thibodeau und Lera Boroditsky lie
ßen knapp 500 Proband*innen in mehreren Experimenten
einige Textstellen über die steigenden Kriminalitätsraten
in der fiktiven Stadt Addison lesen und wurden dann dazu
befragt. Der einzige Unterschied: In manchen Texten wurde
die dramatisch zunehmende Kriminalität mit einem verhee
renden Virus verglichen, in den anderen mit einer wütenden
Bestie. Die Zahlen und Kriminalstatistiken waren jeweils
identisch. Diejenigen Proband*innen, die es in ihren Texten
mit einemUntier zu tun gehabt hatten, rieten mehrheitlich zu
unnachgiebiger Verfolgung, Inhaftierung und harten Sanktio
nen, während die Virus-Metapher die Probanden mehrheit
lich in Richtung Ursachenerkundung, Armutsbekämpfung
und besserer Bildungschancen tendieren ließ.
Abschließend sollten die Teilnehmer*innen noch darüber Aus
kunft geben, welcher Teil der Berichte ihrer Meinung nach
für sie am stärksten meinungsbildend war. Lediglich 15 Per
sonen nannten die sprachliche Metapher als Grund, während
die überragende Mehrheit überzeugt war, dass es vor allem
die Zahlen und Fakten gewesen seien, die für ihre Wahl der
Maßnahmen ausschlaggebend waren. Sprachbilder wirken
also stark unbewusst.
Wenn also bei uns hier und heute allenthalben von »Flücht
lingskrise«, »Flüchtlingswelle«, »Flüchtlingsflut« die Rede ist –
was liegt näher, als Dämme zu bauen, wenn doch ein Tsuna
mi das Land bedroht? Die Begriffe »Sozialtourismus« oder
»Wirtschaftsflüchtling« suggerieren, dass Flucht und Migra


















