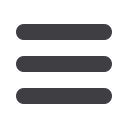
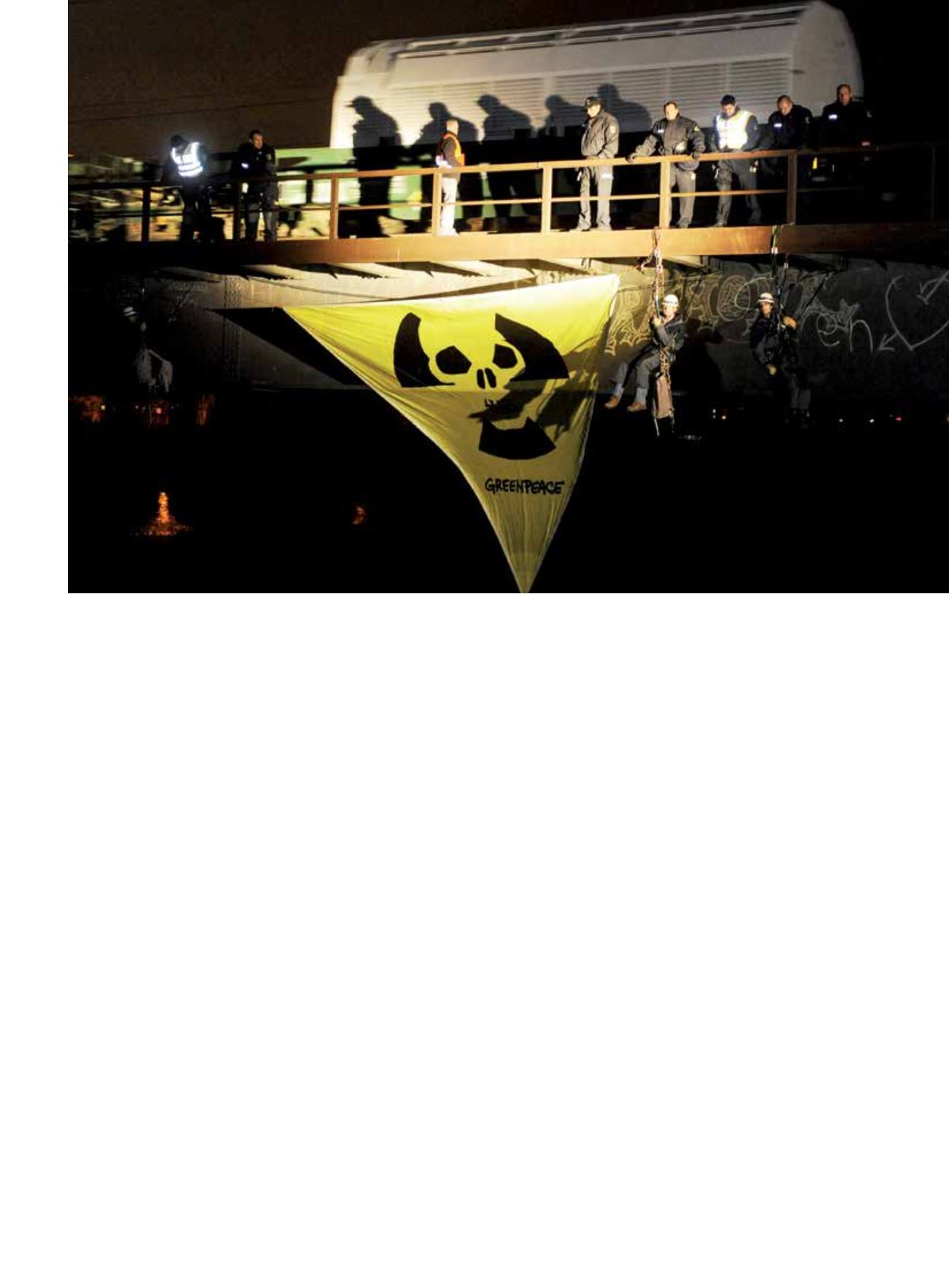
|23 |
aviso 3 | 2016
ANTHROPOZÄN - DAS ZEITALTER DER MENSCHEN
COLLOQUIUM
Professor Dr. Jens Kersten
ist Inhaber der Professur
für Öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften an der
Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-
Universität München; 2012-2013 war er Carson Professor
am Rachel Carson Center for Environment and Society der
Ludwig-Maximilians-Universität.
die klassische Bundesrepublik legitimiert haben: Ingenieure,
Kirchen, Gewerkschaften und Unternehmen – angereichert
um Umweltverbände.
Diese gesamtgesellschaftliche Diffusion der Verantwortung
für den Atommüll prägt auch das eigentliche Standortaus-
wahlverfahren, das sich an das Standortkriterienverfahren
anschließt: Das Standortauswahlgesetz verdoppelt die Atom-
behörden, integriert Bundesministerien und Landesverwal-
tungen, schafft ein neues »gesellschaftliches Begleitgremium«
und überzieht die Republik mit atomaren »Bürgerdialogen«.
Alles dies wird gesetzlich so organisiert, dass zunächst wis-
senschaftliche Expertinnen und Experten entscheiden und
schließlich die gesamte Gesellschaft beteiligt wird, wäh-
rend Regierungen, Behörden und Bundestag eine neutrale,
zunächst moderierende Rolle ausfüllen und schließlich die
staatsnotarielle Beglaubigung der Konkretisierung der gesell
schaftlichen Standortauswahl vornehmen.
IN DIESEM POLITISCH
»aseptischen Konzept der Gover-
nance« (Bruno Latour) entscheidet sich die atomare Stand-
ortfrage quasi von selbst: Sie wird auf möglichst alle gesell-
schaftlichen Kräfte verteilt, sodass sich niemand konkret
verantworten muss – schon gar nicht der Staat, der sich vor-
nehm zurückhält. Der Staat möchte nicht mehr »Atomstaat«
sein. Bilder wie aus Brokdorf, Kalkar, Wackersdorf und Gor-
leben soll es jedenfalls für ihn nicht mehr geben. Deshalb
schafft das Standortauswahlgesetz die »Atomgesellschaft«.
Das Apolitische dieser Governance zeigt sich, wenn man die
Protestfrage stellt: Wo sollten Gegner der atomaren Endla-
gerung gegenwärtig protestieren? Vor dem Bundestag, vor
dem Bundesrat, vor dem Bundeskanzleramt, vor dem Bun-
desumweltministerium, vor den Staatskanzleien der Länder,
vor demBundesamt für Strahlenschutz, vor demBundesamt
für kerntechnische Entsorgung, vor Wissenschaftsinstituten,
vor den Sitzen von Umweltverbänden, vor Kirchen, vor Wirt-
schaftsunternehmen oder vor Gewerkschaftshäusern? Oder
ist der Protest von Bürgerinnen und Bürgern gegen atomare
Endlagerung in Zukunft sogar ein politischer Selbstwider-
spruch, da hierfür in der »Atomgesellschaft« alle verant-
wortlich sind?
So haben wir uns in Deutschland für die unpolitische »Ent-
sorgung« unseres Teils des atomaren Mülls der Menschheit
entschieden. Wir versenken ihn in der tiefen Zukunft des
Anthropozän, von der wir nicht einmal wissen, ob man un-
sere gelb-schwarzen Atomwarnschilder dort überhaupt noch
verstehen kann oder sie vielleicht doch nur für archaische
Kunst halten wird.
oben
Ein Zug mit Castor-Behältern fährt über eine Brücke bei Kehl. Darunter hängen Greenpeace-Aktivisten, die mit einem Transparent
gegen den Transport demonstrieren.


















