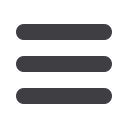

|25 |
aviso 3 | 2016
ANTHROPOZÄN - DAS ZEITALTER DER MENSCHEN
COLLOQUIUM
»Ein Bakterium«, »eine neue Antriebskraft oder was mit
Öl«, »ein Medikament gegen Zahnstein« – das sind nur
einige Antworten, die wir imAugust 2012 von unseren Besu-
cherinnen erhielten, als wir sie fragten, ob ihnen der Begriff
»Anthropozän« etwas sage. Nicht gerade ermutigend, wenn
man sich entschlossen hat, die weltweit erste große Ausstel-
lung zu diesem Thema zu machen. Ist das Anthropozän zu
komplex und zu aktuell, um ausgestellt zu werden? Lohnt
sich der finanzielle und konzeptionelle Aufwand, wenn die
Menschen schon den Titel nicht verstehen? Möchten unsere
Besucher nicht eher »leichte Kost«, wenn sie in ihrer Freizeit
mit Kind und Kegel ins Deutsche Museum kommen? Kann
sich eine Ausstellung der schwerwiegenden Frage annehmen,
ob die Menschen ein neues Erdzeitalter prägen und trotzdem
die Idee des Gründungsvaters Oskar von Miller einhalten,
eine Mischung aus Bildungsstätte und Oktoberfest zu sein?
Anderthalb Jahre nach der Eröffnung der Sonderausstel-
lung »Willkommen imAnthropozän. Unsere Verantwortung
für die Zukunft der Erde« können wir sagen: Ja, man kann.
Warum aber kommt ein Technikmuseum auf die Idee, eine
Ausstellung zu einem in der breiten Öffentlichkeit noch kaum
bekannten Thema zu machen, das man wohl eher in einem
Naturkundemuseum vermuten würde? Impulsgeber gab es
viele, vor allem aus den Reihen des Rachel Carson Center for
Environment and Society, mit dem das Deutsche Museum
die Ausstellung gemeinsam realisierte. Die eigentliche Ant-
wort ist aber denkbar einfach: Zum einen sind die Themen
hinter dem sperrigen Begriff Anthropozän keineswegs total
neu und zum anderen berühren sie unser menschliches Tun
in seiner technischen, naturwissenschaftlichen, kulturellen
und sozialen Gesamtheit. Zwar kannten die meisten Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen unserer Besucherstudie noch
nicht den Fachterminus, die Frage, ob sich das Verhältnis von
Mensch und Natur in den letzten Jahrhunderten und Jahr-
zehnten verändert hätte, bejahten sie jedoch mit überwäl-
tigender Mehrheit (93 Prozent). Einerseits erkannten viele
ein zunehmendes Umweltbewusstsein, andererseits aber
auch die wachsenden menschlichen Eingriffe in natürliche
Kreisläufe. Viele sahen das Verhältnis zur Natur skeptisch
und betonten die egoistische Ader der Menschheit, die Na-
tur allein zu ihrem Vorteil zu nutzen.
Der Mensch als Teil der Natur, als ihr Veränderer, vielleicht
sogar ihr Zerstörer? Keine wirklich neue Idee, mag man
denken. Und doch ist das Anthropozän als Konzept, Per-
spektive und geologischer Begriff etwas Neues, ja in man-
cherlei Hinsicht gar etwas Revolutionäres, denn es begreift
den Menschen als einen bio- und geologischen Akteur, der
imstande ist, die Erdgeschichte zu verändern. Damit steigt
der Mensch auf in die Riege anderer geologischer Kräfte wie
der Vulkanismus oder die Plattentektonik. Dass wir unsere
Umwelt arg strapazieren und Strategien der Nachhaltigkeit
wichtiger denn je sind, ist nicht neu. Doch das Konzept des
Anthropozäns vermag es, bislang isoliert oder parallel zuein
ander betrachtete Phänomene und Probleme zu bündeln
und miteinander in Beziehung zu setzen. Und es trägt der
nicht unwesentlichen Tatsache Rechnung, dass wir zwar in
einer Reihe mit anderen erdsystemischen Akteuren wie den
Cyanobakterien stehen, anders als diese jedoch Bewusst-
sein über unser Handeln besitzen. Gewollt oder ungewollt,
der Mensch ist nun am Steuer – im »driver’s seat« wie es im
Englischen heißt. Doch wohin geht die Reise?
Das Deutsche Museum mit seinen Sammlungen aus histo-
rischen, aber auch gegenwärtigen Objekten verschiedenster
naturwissenschaftlicher und technischer Fachgebiete kann
auf ganz besondere Weise erklären, wie, wann, wo und
warum wir Menschen unsere Umwelt kontinuierlich verän-
dern. Schließlich waren es die Prozesse der Industrialisierung
und Globalisierung, die die Phänomene des Anthropozäns
hervorgebracht und beschleunigt haben. Technik als Verur-
sacher oder Verstärker anthropogener Umwelteinflüsse und
zugleich Teil möglicher Lösungen nimmt eine wichtige Rolle
ein. Als menschengemachte Ausprägung unseres kreativen
Potenzials erfordert sie eine gesellschaftliche Diskussion
über ihre Entwicklung, Anwendung und Nutzen in unserer
gegenwärtigen und zukünftigen Welt, insbesondere wenn
sie wie zum Beispiel beim Geo-Engineering globale Aus-
wirkungen hat.
Konzept der offenen Fragen
Das Anthropozän steht für einen möglichen neuen Abschnitt
der Erdgeschichte. Es ist aber auch eine Zäsur für das Muse
um als Sammlung, Ausstellungsort und Wissensinstitution.
Als Prozess und Ergebnis menschengemachter, oft beschleu-
nigter Veränderungen scheint das Anthropozän demGedan-
ken des Museums – der Konservierung und Kategorisierung –
diametral entgegenzustehen. Doch heutige Museen sind nicht
mehr nur Archive, sondern vielmehr Akteure des Anthro-
pozäns: Sie lagern und konservieren Gegenstände, die als
Bausteine seiner Entstehungsgeschichte betrachtet werden
können, und setzen es mittels unterschiedlicher Anordnung
dieser Bausteine zugleich auf immer wieder neue Art und
Weise zusammen. In der Theorie des Museums verspricht
das Anthropozän deshalb spannende Perspektiven, neue
Kooperationsmöglichkeiten und eine Aktualität und Rele-
Eine Bilanz der Ausstellung im Deutschen Museum
Text:
Nina Möllers
museumsreif?


















