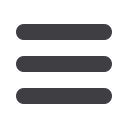

|31 |
aviso 3 | 2016
ANTHROPOZÄN - DAS ZEITALTER DER MENSCHEN
COLLOQUIUM
Text:
Karin Fellner
Das Grundstück ist uns von den Eltern verboten worden.
»Eltern haften –«, das Wort »haften« kenne ich nicht, es
scheint mir verwandt mit den Linoleumfluren unserer Schule.
Am Schild vorbei steigen wir ein und hinunter in den halb-
wegs erhaltenen Keller, klettern über Schutt in poröse und
feuchte Gerüche. Eine alte Weide überschattet das Abbruch-
loch, vielleicht eine Hybride, Salix fragilis x Salix babylonica.
Ins Erinnerungsbild projiziert sich der Name »Trauerweide«
sowie das viel später erst vollzogene Erkennen: Denkt man
das Wurzelwerk mit, steht man am Stamm nicht
unter
, son-
dern
inmitten
des Baums.
Als unser Auto nach den Ferien in die Straße einbiegt und
etwas über den Dächern fehlt, brauch ich, um zu erkennen,
was. Dann stehe ich zwischen Asthaufen, sie riechen süß, der
zerstückelte Stamm, Wespen fliegen und fräsen. Den Stumpf
schmücken wir noch am selben Tag mit Blumen und dem
in Folie eingeklebten Gedicht von Eugen Roth:
Zu fällen
einen schönen Baum, / braucht’s eine halbe Stunde kaum. /
Zu wachsen, bis man ihn bewundert, / braucht er, bedenk’ es,
ein Jahrhundert.
Für mein neunjähriges Verständnis tref-
fen die Verse zumindest einen Teil dessen, was diese »Trauer-
Weide« mir bedeutet, ein Verlust, für den uns niemand »haf-
tet«. Während wir das Gedicht niederlegen, biegt der Nach-
bar seine Thujen zur Seite und ruft lachend: »Jetzt bringen
die da auch noch Blumen …!«
In dieser Erinnerungssequenz ballt sich einiges, das mir den
Stachel des Schreibens einpflanzte und mich noch heute,
teils in verwandelter Form, befeuert, bedrängt: Die Freude
an ungenutzten, wuchernden Flächen. Die Gemengelage aus
Empörung und Weh beim Verlust von lebender Welt. Das
schockartige Erstaunen, dass jemand nicht in der Lage war
zu sehen, was doch offen »zu Tage« lag.
*bezeugen*
Im Film »Metropia« liegt die urbane Agglomeration »Eu-
ropa« in düsterem Zwielicht. Vernieselte Gleichförmigkeit,
ubiquitäre Überwachung. Auf einem Bahnsteig des konti-
nentweiten U-Bahn-Netzes spricht ein Mann in die war-
tende Menge. Sinngemäß sagt er:
Frühling, Sommer, Herbst
und Winter. Ich bezeuge, dass es sie gab, ich bezeuge, dass es
Jahreszeiten gab.
Schon der literarische »Wald« der Romantik war ein Versuch,
die der Industrie zumOpfer fallende Wildnis hereinzuholen
in Schrift:
Kennst du noch die irren Lieder / Aus der schönen,
alten Zeit? / Sie erwachen alle wieder / Nachts in Waldesein-
samkeit, / Wenn die Bäume träumend lauschen / Und der
Flieder duftet schwül / Und im Fluß die Nixen rauschen – /
Komm herab, hier ist’s so kühl.
Heute erscheint mir Eichen-
dorffs Wort »Waldeseinsamkeit« selbst wie ein »irres« Relikt.
In den rund um die Uhr vom Flugverkehr überrauschten
Waldrudimenten Europas existiert »Waldeseinsamkeit« nur-
mehr als fernes Echo. Unseren fortschreitenden Überfor-
mungsprozessen fallen täglich ja nicht nur Lebensräume und
Arten und für selbstverständlich gehaltene Zustände (etwa:
die
dunkle
Nacht) zum Opfer, sondern auch entsprechende
Worte. Wenn etwa das in seiner Massivität noch immer nicht
geklärte Eschentriebsterben in Europa weiter fortschreitet,
wird das Wort »Esche« womöglich bald ein Erinnerungs-
marker sein, ohne Leben für jüngere Generationen. Der Akt
des Bezeugens im Nachhinein, in eine Welt hinein, die das
Bezeugte nicht mehr kennt, hat – wie der Bahnsteigredner
in »Metropia« – etwas Trotzig-Hilfloses. Ich sage Elfenbein-
specht. Ich sage Harlekinfrosch. Ich sage Szaferi-Birke – aus-
gestorbene Namen. Was könnte über das Aufrufen hinaus
–
die farne gibt es; und brombeeren, brombeeren / und brom
gibt es; und den wasserstoff, den wasserstoff
(Inger Christen-
sen) – eine Sprache des Bezeugens sein?
Verdächtig erscheinen mir Narrative, wie sie zumBeispiel gern
in Tierdokumentationen verwendet werden. Die Erzählung
rund um die »faszinierende Tierwelt« schließt in der Regel
mit mahnenden Standardsätzen wie:
Bedauerlicherweise ist
der Lebensraum der Elefanten / Buckelwale / Glattrochen /
Hufeisennasen etc. vom Menschen bedroht.
Das Filmteam
in Outdoor-Kleidung, mit Jeep und High-Tech-Equipment
bleibt außerhalb des Bildes. Ein derartiges Faszination-plus-
Moral-Narrativ entmischt menschliche Einflussnahme und
»unberührte« Natur und macht es damit leicht, Wirklichkeit
zu spalten und von sich selbst wegzuhalten.
In den 80-ern klebte auch auf meiner Schultasche der Spruch:
Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet,
der letzte Fisch gefangen ist, werdet Ihr merken, dass man
Geld nicht essen kann.
Er stammt nicht wie behauptet von
den Cree, sondern wurde von der Umweltbewegung getex-
GLOBALOCALACOLABOLG-Palindromschleifenzeichnung (Ausschnitt), © Olaf Probst 2016


















