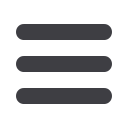

51
Die Entstehung von Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus
Einsichten und Perspektiven 2 | 17
Die Entstehung von Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus in
Deutschland vollzog sich in langwierigen, schwierigen und vielfach von massiven
politisch-gesellschaftlichen Konflikten begleiteten Prozessen und vor dem Hinter-
grund verschiedener Rahmenbedingungen.
1
Dazu gehörte neben den Vorgaben
und Entscheidungen der Besatzungsmächte vor allem die wirtschaftliche Notlage
aufgrund der Kriegszerstörungen, hier besonders die Wohnungsnot, die zudem noch
verstärkt wurde durch das Erfordernis, mehrere Millionen Flüchtlinge und Heimatver-
triebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und anderen Teilen Mittel- und
Osteuropas aufzunehmen. Auch die zwischen den Siegermächten entstandenen
Konflikte, die in dem „Kalten Krieg“ mündeten, hatten erhebliche Auswirkungen auf
die Herausbildung von Gedenk- und Erinnerungskulturen in den verschiedenen Teilen
Deutschlands. Auf der Ebene kollektiver Einstellungen sind zudem die Deutungs- und
Verhaltensmuster der Bevölkerung sowie populäre Geschichtsbilder einzubeziehen.
2
In der Literatur lässt sich ein sehr unterschiedlicher Gebrauch
des Begriffs „Gedenkstätte“ ausmachen. In einem sehr weit
gefassten Begriffsverständnis werden dabei auch Mahn-
male und Gedenktafeln, die an Opfer von NS-Verbrechen
erinnern, einbezogen. In den letzten Jahrzehnten hat sich
der engere Begriff der „arbeitenden“ Gedenkstätte etab-
liert. Danach werden als Gedenkstätten Einrichtungen
wie beispielsweise in Dachau und Flossenbürg bezeichnet,
„die neben Gebäuden, Geländen und sonstigen originalen
Zeugnissen wie Akten, Fotos usw. über ein Archiv, eine
Ausstellung und ein Minimum an Personal zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben verfügen.“
3
Diese Veränderungen
der Begrifflichkeit spiegeln aber auch die Entwicklung des
Opfergedenkens nach 1945 wider.
Unmittelbar nach der Befreiung im April und Mai 1945
durch Truppen der Alliierten waren es zunächst die über-
lebenden, aus vielen europäischen und außereuropäischen
Ländern stammenden Häftlinge der Konzentrationslager,
1 Vgl. dazu ausführlich: Cornelia Siebeck: 50 Jahre „arbeitende“ NS-Ge-
denkstätten in der Bundesrepublik. Vom gegenkulturellen Projekt zur
staatlichen Gedenkstättenkonzeption – und wie weiter?, in: Elke Gryglew-
ski u.a. (Hg.): Gedenkstättenpädagogik. Kontext, Theorie und Praxis der
Bildungsarbeit zu NS-Verbrechen, Berlin 2015, S. 19–43.
2 Vgl. Edgar Wolfrum: Die geglückte Demokratie. Geschichte der Bundes
republik von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Bonn 2007, S. 171.
3 Wulff E. Brebeck: Gedenkstätten für NS-Opfer im kollektiven Gedächtnis
der Bundesrepublik Deutschland, in: Arbeitskreis NS-Gedenkstätten NW
(Hg.): Den Opfern gewidmet – auf Zukunft gerichtet. Gedenkstätten für die
Opfer des Nationalsozialismus in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf o.J., S. 6.
die Gedenkveranstaltungen für ihre während der Lager-
zeit ermordeten und umgekommenen Kameraden abhiel-
ten. Sie errichteten auch bereits Mahnmale aus vorhande-
nen Materialien wie Holz und Textilien, die überwiegend
jedoch nur temporärer Art waren.
4
Fast zeitgleich mussten
auf Anordnung der amerikanischen Besatzungsbehörden
etwa tausend Weimarer Bürger das Konzentrationslager
besichtigen und sich mit eigenen Augen von den dort
begangenen Verbrechen überzeugen.
5
In Dachau wurden
dreißig Honoratioren der Stadt zu einem Zwangsbesuch im
Krematorium des Lagers verpflichtet. Die Reaktionen dar-
auf waren nicht nur Schrecken und Betroffenheit, sondern
stärker noch Abwehr mit dem Hinweis, man habe von den
Geschehnissen hinter den Absperrungen des Lagers nichts
gewusst und habe damit überhaupt nichts zu tun.
6
Hier
wird bereits die Grundkonstellation der folgenden Jahr-
zehnte deutlich. Es sind zu dieser Zeit fast ausschließlich
die überlebenden Opfer und Verfolgten des Naziregimes,
4 Vgl. Stefanie Endlich: Orte des Erinnerns – Mahnmale und Gedenkstätten,
in: Peter Reichel u.a. (Hg.): Der Nationalsozialismus – Die zweite Geschich-
te. Überwindung – Deutung – Erinnerung, München 2009, S. 350–377, hier
S. 352.
5 Vgl. Jens Schley: Nachbar Buchenwald. Die Stadt Weimar und ihr Konzen-
trationslager 1937–1945, Köln/Weimar/Wien 1999, S. 1ff.
6 Vgl. Sybille Steinbacher: „… daß ich mit der Totenklage auch die Klage um
unsere Stadt verbinde“. Die Verbrechen von Dachau in der Wahrnehmung
der frühen Nachkriegszeit, in: Norbert Frei/Sybille Steinbacher (Hg.): Be-
schweigen und Bekennen. Die deutsche Nachkriegsgesellschaft und der
Holocaust, Göttingen 2001, S. 11–33, hier S. 16 f.


















