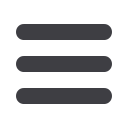

55
Die Entstehung von Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus
Einsichten und Perspektiven 2 | 17
die Unterbringung von Flüchtlingen und Vertriebenen
benutzten und zur „Wohnsiedlung Dachau-Ost“ umge-
stalteten. Als Gedenkort war damals nur der Krematori-
umsbereich verblieben, in dem 1950 das „Denkmal des
unbekannten Häftlings“ aufgestellt und einige Monate
später eine wiederum von ehemals Verfolgten erarbei-
tete neu gestaltete Ausstellung eröffnet wurde, die jedoch
1953 nach einer heftigen Medienkampagne im Vorjahr
von der für die Gedenkstätte zuständigen „Staatlichen
Verwaltung der bayerischen Schlösser, Gärten und Seen“
wieder geschlossen wurde. Zwei Jahre später beantragte
der CSU-Abgeordnete Heinrich Junker, zugleich Dach-
auer Landrat, im Bayerischen Landtag sogar die Schlie-
ßung des Krematoriumsgeländes, dem sich auch andere
Landespolitiker anschlossen. Dieser Vorstoß, der bei den
ehemaligen Häftlingen große Entrüstung auslöste, schei-
terte aber daran, dass sich die Bundesrepublik Deutsch-
land in einem Zusatzabkommen zu den Pariser Verträgen
verpflichtet hatte, die Unantastbarkeit von Grabstätten
von Opfern des NS-Regimes zu garantieren.
Die Initiative zur Errichtung einer Gedenkstätte auf dem
Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau ging
von den Überlebenden aus, die sich 1955 am 10. Jahrestag
der Befreiung in Dachau trafen. Die ehemaligen Häftlinge –
vor allem aus den westeuropäischen Ländern, die dort teil-
weise bedeutende Positionen in Politik und Gesellschaft
innehatten – zeigten sich bestürzt über die Zustände im
ehemaligen Häftlingslager, das jetzt als Wohnlager diente.
So kam es anlässlich dieses Jahrestages zur Neugründung
des Internationalen Häftlingskomitees von 1945
(Comité
International de Dachau
– CID), das die Errichtung einer
würdigen Mahn- und Gedenkstätte zum Ziel hatte. In den
folgenden Jahren ging es zunächst darum, sowohl einen
Aufnahmestopp für das Wohnlager durchzusetzen und eine
Umsiedlung der Bewohner zu bewerkstelligen, als auch
Personen in Schlüsselstellungen für die Unterstützung des
Projektes zu gewinnen. Für die Verwirklichung war das
Engagement des CID unter seinem langjährigen Präsiden-
ten, dem belgischen General Albert Guerisse, von entschei-
dender Bedeutung. Auf deutscher Seite sind der langjährige
bayerische Staatsminister Alois Hundhammer (CSU), der
1933 im KZ Dachau inhaftiert war, der Münchner Weihbi-
schof Johannes Neuhäusler, 1941 bis 1945 Sonderhäftling
in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau,
sowie der ehemalige kommunistische Häftling Otto Kohl-
hofer als Vorsitzender der deutschen Lagergemeinschaft
und Mitglied des CID hervorzuheben.
Mit der Errichtung einer katholischen Gedenkkapelle
„Todesangst Christi“ anlässlich des 37. Eucharistischen
Weltkongresses wurde bereits 1960 auf dem Gelände
der geplanten Gedenkstätte eine religiöse Gedenkanlage
geschaffen. Im gleichen Jahr wurde auch eine provisori-
sche Ausstellung des CID in den Räumen des großen Kre-
matoriums eröffnet. 1962 kam es zu einer Vereinbarung
zwischen dem Freistaat Bayern und dem CID über die
Ausgestaltung und Finanzierung der Gedenkstätte im ehe-
maligen KZ Dachau. Im Laufe der nächsten Jahre wurden
die freigewordenen Baracken abgerissen, das Schutzhaft-
lager hergerichtet und zwei Baracken rekonstruiert. Eine
Arbeitsgruppe aus ehemaligen Häftlingen und Fachbera-
tern stellte, gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des CID,
die Ausstellung in dem zum Museum umgewandelten
ehemaligen KZ-Wirtschaftsgebäude nach der Konzep-
tion des CID zusammen. Die Eröffnung der neu gestal-
teten Gedenkstätte fand anlässlich des 20. Jahrestages der
Befreiung Anfang Mai 1965 statt. Schon 1964 wurde das
Kloster „Heilig Blut“, das unmittelbar an die Mauer des
ehemaligen Häftlingslagers angrenzt, eingeweiht. 1967
kamen zwei weitere religiöse Gedenkanlagen – die evan-
gelische Versöhnungskirche und die jüdische Gedenk-
stätte – hinzu. Mit der Errichtung des Internationalen
Mahnmals im September 1968 wurde die Neugestaltung
der Gedenkstätte vervollständigt.
Allerdings wurden damals auf Beschluss des von poli-
tischen Häftlingen und Widerstandkämpfern (roter
Winkel) dominierten CID die Opfergruppen der Homo-
sexuellen (rosa Winkel), der in der Naziterminologie so
bezeichneten „Berufsverbrecher“ (grüner Winkel) und der
„Asozialen“ (schwarzer Winkel), die als „Kriminelle“ und
nicht als Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes
angesehen wurden, aus dem Gedenken ausgegrenzt. Erst
im Laufe weiterer Jahrzehnte und nach teilweise heftigen
öffentlichen Auseinandersetzungen konnten diese „ver-
gessenen“ und von der Gesellschaft vielfach weiterhin
diskriminierten Verfolgtengruppen einen angemessenen
Platz sowohl in der Gedenkstätte Dachau wie auch in
der Gedenk- und Erinnerungskultur der Bundesrepublik
erreichen.
25
Gedenkstätten in der DDR
Zwischen 1945 und 1950 bestanden auf dem Gelände
der ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald und
Sachsenhausen als „Speziallager“ bezeichnete Internie-
rungslager des sowjetischen Geheimdienstes (NKWD/
25 Vgl.
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/station13.html[Stand:
25.03.2017].


















