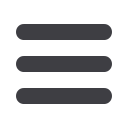
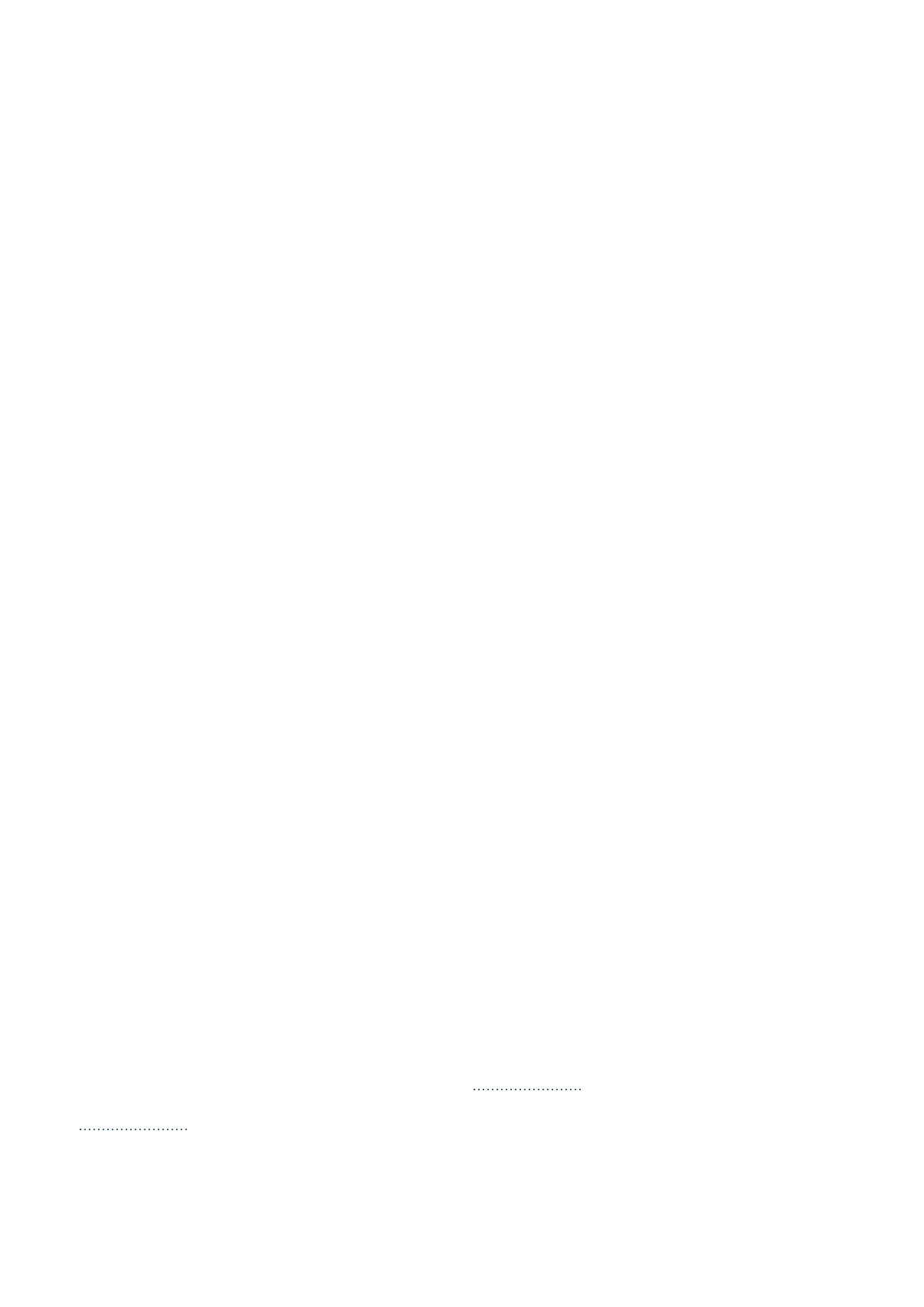
56
Die Entstehung von Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus
Einsichten und Perspektiven 2 | 17
MKD), in denen überwiegend NSDAP-Funktionäre und
Gegner der Besatzungsmacht gefangen gehalten wurden.
26
Das Gelände des ehemaligen KZ Ravensbrück wurde von
1945 bis 1994 von der Sowjetarmee bzw. den GUS-Streit-
kräften militärisch genutzt.
27
Nach der Auflösung der Speziallager begannen in der
DDR die Planungen für drei „Nationale Mahn- und
Gedenkstätten“(NMG).
28
Die von der SED politisch vor-
gegebene Geschichtsinterpretation, die in den Gedenk-
stätten vermittelt werden sollte, hob die „Rolle der KPD
als stärkster und führender Kraft gegen das verbrecheri-
sche Naziregime“ und den „antifaschistischen Wider-
stand“ hervor und leitete daraus „die historische Rolle der
Deutschen Demokratischen Republik“ als Konsequenz
der geschichtlichen Entwicklung ab. Die Gestaltung aller
drei Mahn- und Gedenkstätten wurde von einer Gruppe,
dem „Kollektiv Buchenwald“, nach einheitlichen inhalt-
lichen und künstlerischen Richtlinien entwickelt. 1958
wurde die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchen-
wald eingeweiht, die aber nicht auf dem historischen Ort
des Konzentrationslagers, sondern in einiger Entfernung
am Südhang des Ettersberges errichtet wurde. Ein Jahr
später wurde die NMG Ravensbrück am Rande des Lager-
geländes auf einer kleinen Fläche zwischen der Lager-
mauer und dem Schwedtsee eröffnet. 1961 folgte Sach-
senhausen. Diese drei Einrichtungen waren personell und
materiell großzügig ausgestattet, während andere Orte
mit ähnlicher historischer Bedeutung wenig beachtet und
vernachlässigt blieben. So wurde erst 1966 im Kremato-
rium des ehemaligen KZ Mittelbau-Dora eine Mahn- und
Gedenkstätte mit einer kleinen Ausstellung eingerichtet,
für die sich vor allem ehemalige Häftlinge, insbesondere
aus Frankreich und Belgien, eingesetzt hatten. Ein Jahr
zuvor wurde in dem Zellentrakt des ehemaligen KZ im
Schloss Lichtenberg eine Mahn- und Gedenkstätte eröff-
net, die ebenfalls auf die Initiative ehemaliger Häftlinge
zurückging.
Zusammenfassung
In dem ersten Vierteljahrhundert nach der Befreiung
waren es vor allem Opfer der nationalsozialistischen Ver-
folgung – insbesondere ehemalige politische Häftlinge und
Widerstandskämpfer – und deren Angehörige, die sich
für die Errichtung von Mahnmalen und Gedenkstätten
26 Vgl. Endlich u.a. (wie Anm. 12), S. 323 und 896 f.
27 Vgl. ebd., S. 272.
28 Vgl. zum Folgenden: Endlich (wie Anm. 4), S. 354 und 360.
einsetzten. Unterstützung bekamen sie von kleinen Grup-
pen und einzelnen Personen aus dem christlichen und
linken Spektrum der Gesellschaft, die sich bereits damals
für einen offenen Umgang mit der nationalsozialistischen
Vergangenheit einsetzten und deren frühes Engagement
sich auch für die spätere Entwicklung von Gedenkstät-
ten als bedeutsam erweisen sollte. So wurde die 1958 auf
der Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands ins
Leben gerufene „Aktion Sühnezeichen“ (ab 1968: Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste), die in den Sechziger und
Siebziger Jahren viele Freiwillige zu sozialen Hilfsdiens-
ten ins Ausland, darunter auch in polnische Gedenkstät-
ten, entsandte, in den achtziger Jahren mit ihrem 1983
gegründeten Gedenkstättenreferat zu einem Kristallisati-
onskern der sich damals entwickelnden Gedenkstätten
arbeit und -initiativen.
29
Es darf aber auch nicht übersehen werden, dass in der
Bundesrepublik infolge des „Ost-West-Konfliktes“ die
kommunistischen Opfer des Nationalsozialismus erneut
stigmatisiert und verfolgt wurden. Der kommunistische
Widerstand hatte in der Erinnerungs- und Gedenkkultur
zunächst nicht nur keinen Platz, sondern er wurde durch
die damals vorherrschende Totalitarismustheorie, die
Nationalsozialismus und Stalinismus als ähnliche diktato-
rische Systeme ansah, in ein negatives Licht gesetzt.
30
Wenngleich jede Gedenkstätte ihre eigene Entste-
hungsgeschichte hat, lassen sich in vielen Fällen Desin-
teresse und Ablehnung durch die lokale Bevölkerung,
Behörden und politische Entscheidungsträger ausma-
chen. In diesen Entstehungsgeschichten spiegelt sich
der Umgang der bundesrepublikanischen Gesellschaft
mit der Nazivergangenheit, der bei genauerer Betrach-
tung zwar nicht auf den schlichten Gegensatz von Ver-
drängung oder Aufarbeitung reduziert werden kann,
aber doch auf der Ebene der Erinnerungspolitik durch
einen defensiven Pragmatismus und auf der Ebene der
kollektiven Einstellungen überwiegend durch Ignoranz
und Selbstviktimisierung gekennzeichnet war. Die Ent-
wicklung des Opfergedenkens und die Etablierung von
Gedenkstätten in der (alten) Bundesrepublik wird aus
heutiger Sicht vielfach als „Erfolgsgeschichte“ gedeu-
tet. Für das erste Vierteljahrhundert nach der Befreiung
29 Vgl. Manfred Wittmeier: Internationale Jugendbegegnungsstätte Ausch-
witz. Zur Pädagogik der Erinnerung in der politischen Bildung, Frankfurt
am Main 1997, S. 216 f.; Wolfgang Raupach-Rudnick: Die Gründung des
Gedenkstättenreferates der Aktion Sühnezeichen e.V., in: Gedenkstätten-
Rundbrief Nr. 100 (2001), S. 9–12.
30 Vgl. Wolfrum (wie Anm. 2), S. 174.


















