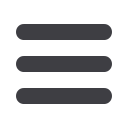
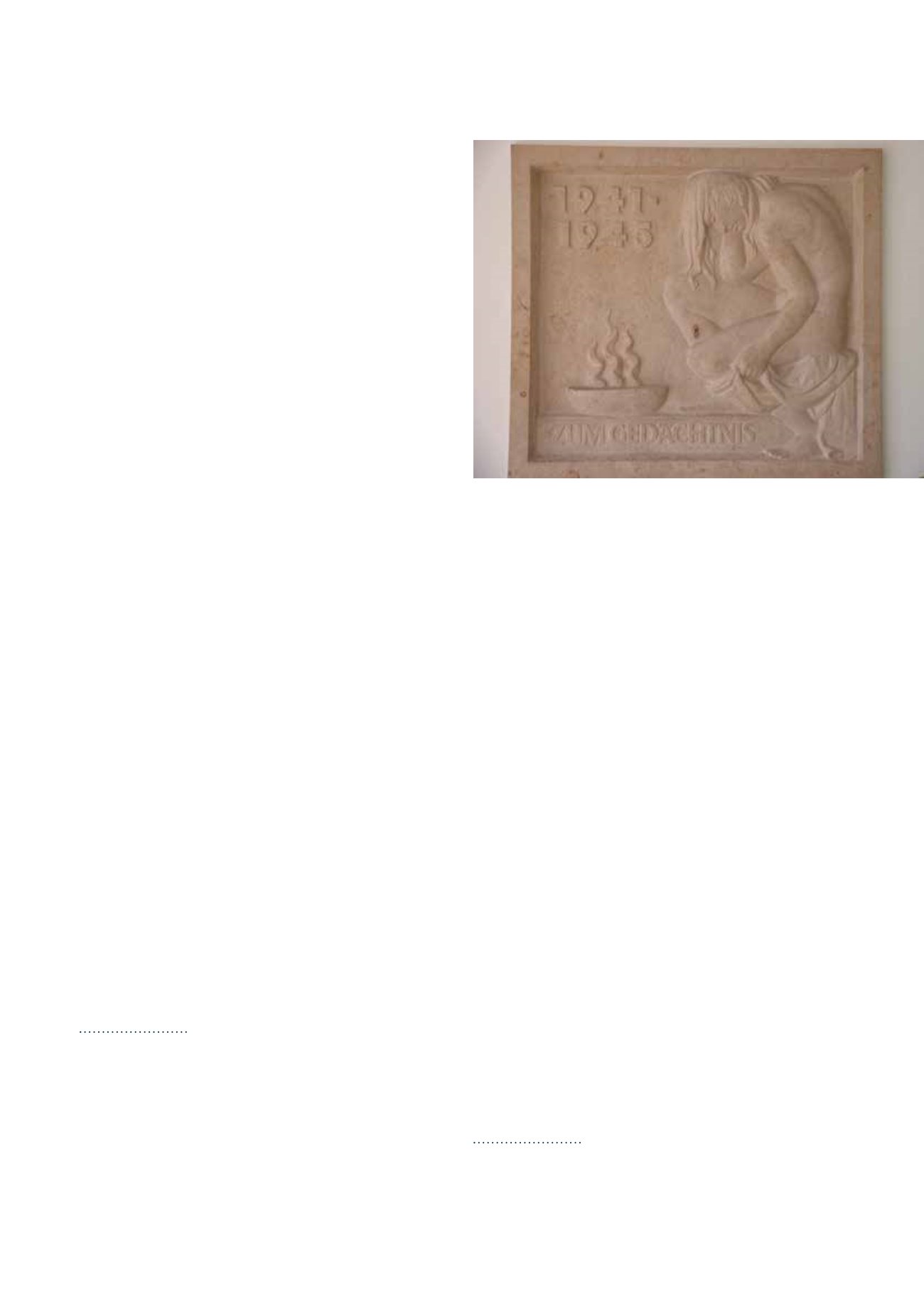
54
Die Entstehung von Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus
Einsichten und Perspektiven 2 | 17
glied der rechtsextremen und später vom Bundesver-
fassungsgericht verbotenen Sozialistischen Reichspartei
(SRP), hatte 1951 die Widerstandskämpfer öffentlich
als Landesverräter bezeichnet. In dem daraufhin von
dem Braunschweiger Generalstaatsanwalt Fritz Bauer
angestrengten Strafprozess wurde die Legitimität dieses
Widerstandes festgestellt und Remer „wegen übler Nach-
rede in Tateinheit mit Verunglimpfung des Andenkens
Verstorbener“
18
verurteilt. Eine positive Bewertung des
militärischen Widerstandes, wie sie in der Schaffung des
Ehrenhofes zum Ausdruck kam, ist zudem aber auch
vor dem damaligen außen- und deutschlandpolitischen
Hintergrund und insbesondere der beabsichtigten Remi-
litarisierung der Bundesrepublik zu sehen. Anderthalb
Jahrzehnte später, 1968, wurde im Bendler-Block die
„Gedenk- und Bildungsstätte Stauffenbergstraße“ mit
einer kleinen ständigen Ausstellung „Widerstand gegen
den Nationalsozialismus“ eröffnet.
19
An die Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“-
Verbrechen wurde erstmals 1953 in Hadamar mit einem
Relief, das die Inschrift „1941–1945 Zum Gedächtnis“
trägt, erinnert.
20
Hadamar gehörte zu den Einrichtungen,
in denen während der Jahre 1940 und 1941 die syste-
matische Ermordung pflegebedürftiger, körperlich und
geistig behinderter Menschen durch Vergasung durch-
geführt wurde. 1964 kam eine Gedenkstätte auf dem
Anstaltsfriedhof hinzu. In Grafeneck,
21
einer weiteren
„Euthanasie“-Mordstätte, wurde 1962 der Heimfried-
hof als Gedenkstätte mit zwei Urnengräbern und einem
Steinkreuz angelegt, aber noch 1965 wurde das historische
Gebäude, in dem die Morde stattfanden, abgerissen.
Eine Ausnahme unter den frühen Gedenkstätten stellt
die 1962 eröffnete Gedenkhalle Schloss Oberhausen dar.
22
Sie geht auf eine kommunale Initiative zurück und war
von vornherein mit einer Dauerausstellung und Bildungs-
angeboten als „arbeitende“ Gedenkstätte angelegt.
1966 erhielt Bergen-Belsen ein Dokumentenhaus mit
einer Ausstellung zur Geschichte des Konzentrations
lagers.
23
18 Fröhlich (wie Anm. 17), S. 221.
19 Endlich (wie Anm. 4), S. 355.
20 Vgl. Puvogel (wie Anm. 8), S. 314ff.
21 Vgl. ebd., S. 39ff.
22 Vgl. Arbeitskreis NS-Gedenkstätten NW (Hg.): Den Opfern gewidmet – auf
Zukunft gerichtet. Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus in
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf o.J., S. 67–70.
23 Vgl. Endlich (wie Anm. 4), S. 355.
Das Beispiel Dachau
An dem ehemaligen Konzentrationslager Dachau lässt
sich exemplarisch der mühevolle Weg von 1945 bis zur
Etablierung einer zwar bescheiden ausgestatteten, aber
immerhin „arbeitenden Gedenkstätte“ im Jahr 1965
aufzeigen.
24
Der gesamte Komplex des vormaligen SS-
Übungslagers und des Konzentrationslagers wurde nach
der Befreiung von der US-amerikanischen Armee über-
nommen. Nachdem im Juli 1945 die letzte Gruppe der
befreiten Häftlinge das ehemalige Konzentrationslager
verlassen hatte, wurde hier ein Internierungslager für NS-
Funktionäre, höhere Beamte und Angehörige der SS ein-
gerichtet. Am 15. November 1945 begann vor einem im
Lagerbereich tagenden amerikanischen Militärgericht der
erste „Dachauer Prozess“ gegen Angehörige des Komman-
danturstabes des KZ Dachau, dem bis 1948 eine Reihe
weiterer Verfahren folgten. Etwa zeitgleich mit dem ersten
Prozess wurden aufgrund des Engagements Überlebender
eine Dokumentarausstellung im Krematorium – die erste
KZ-Ausstellung in Deutschland – und eine Begleitpubli-
kation fertiggestellt.
Nachder Auflösung des Internierungslagers am31. August
1948 übergaben die Amerikaner das ehemalige Schutz-
haftlager den bayerischen Behörden, die das Lagerareal für
24 Vgl. zum Folgenden Harold Marcuse: Das ehemalige Konzentrationslager
Dachau. Der mühevolle Weg zur Gedenkstätte 1945–1968, in: Dachauer
Hefte 6 (Taschenbuchausgabe München 1994), S. 182–205.
Obwohl die Euthanasiemorde im kollektiven Gedächtnis häufig im Schatten
des Holocaust stehen, wird auch diesen, wie hier in der ehemaligen Eutha-
nasieanstalt Hadamar, entsprechend gedacht.
Foto: LWV Hessen


















