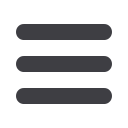

Text:
Susan Arndt
Afrikastudien? So pauschal wie der Name ist oft auch die
Reaktion darauf: »Ach, mein Vater hat alle Leni Riefenstahl-
Bände Zuhause«; oder »Ich lese auch gerade ein Buch über
die Inka«; oder: »Ja, wie heißen diese Fische im Viktoriasee
nochmal?« sind die eher harmloseren Reaktionen. Das Pro-
blem beginnt bereits damit, das in der Bezeichnung dieses
Faches der Name eines Kontinentes auftaucht. Gemeinhin
werden akademische Fächer ja eher nach Methoden, Theo-
rien und Grundlagen der wissenschaftlichen Arbeit benannt,
also etwa Geschichte oder Chemie. Orte, die beforscht werden,
landen in der Regel nicht in den Namen von Disziplinen. Zwar
gibt es die Germanistik, Anglistik oder Romanistik, die nach
den untersuchten Sprach- und Literaturräumen benannt
werden. Doch bei den Afrikastudien werden so diverse wis-
senschaftliche Disziplinen wie etwa Ethnologie, Linguistik,
Soziologie, Filmwissenschaft, Politikwissenschaft, Religions-
wissenschaft, Biologie, Geschichte, Geographie, Umwelttech-
nologie und Literaturwissenschaft in einen Topf geworfen,
sobald die betreffenden Wissenschaftler*innen eines tun:
regelmäßig über den afrikanischen Kontinent forschen –
egal was, egal wo. Das erinnert schon daran, dass über
Afrika oft sehr verallgemeinernd gesprochen wird und Afrika
dabei oft im gleichen Denktopf wie andere ehemals von
Europa kolonisierte Räume landet – siehe die obige Parallele
zwischen Afrikastudien und den Inkas. Und apropos Riefen-
stahl: Tatsächlich ist nicht nur der Name »Afrikastudien«,
sondern auch die Geschichte dieses Faches im kolonialen
Diskurs verankert.
»Wissenschaftliche« Rechtfertigung des Kolonialismus
Als Europa kolonial expandierte, bedurfte es zur Legitimie-
rung von Menschen- und Völkerrechtsverletzungen einer
Rechtfertigungsideologie, die in der Erfindung menschlicher
›Rassen‹ mündete. In einem pan-europäischen Unterfangen
wurde ebenso banal wie fatal proklamiert: Die ›weiße Rasse‹
(und ihr Christentum) sei allen anderen überlegen. Anti-
thetisch wurden die anderen ›Rassen‹ als Natur und dem
Menschsein fern deklariert. Immanuel Kant war Teil dieses
pan-europäischen Projektes und führte den Begriff ›Rasse‹
in den deutschen Kontext ein. Wie andere Aufklärer, und
nach ihm auch Georg Wilhelm Friedrich Hegel, rechtfertigte
er die europäische Versklavung von Afrikaner*innen. Diese
legte den Grundstock für die Industrielle Revolution in
Europa, während sie gleichzeitig nicht nur mehr als
14 Millionen Menschen ihrer Freiheit beraubte und ver-
Afrikastudien in Bayreuth
mutlich ebenso viele Leben auslöschte, sondern auch lang
gewachsene soziale und ökonomische Strukturen auf dem
afrikanischen Kontinent und den Amerikas zerstörte.
Das Ende der Sklaverei tat dem Versuch, Rassismus wissen-
schaftlich zu fundieren, keinen Abbruch. Vielmehr trat der
Kolonialismus in seine imperiale Phase über, deren koloniale
Sehnsucht in Richard Wagners berühmt-berüchtigten Wor-
ten 1848 wie folgt klingt: »Nun wollen wir in Schiffen über
das Meer fahren« und »es deutsch und herrlich machen.«
Diese Vision und Praxis wird 1884 durch die sogenannte
Berliner Konferenz besiegelt. Europa teilt sich Afrika auf und
zieht Grenzlinien, die auf historisch gewachsenen Struktu-
ren keine Rücksicht nehmen. Kurz darauf baut Deutschland
erste Konzentrationslager. In »Deutsch-Südwestafrika«, dem
heutigen Namibia, befiehlt Lothar von Trotha einen deut-
schen Genozid und Eugen Fischer etabliert die Eugenik –
Relikte davon liegen bis heute in deutschen Museen und
Krankenhäusern.
Insofern all dies wenig mit den Idealen von Freiheit, Gleich-
heit und Brüderlichkeit zu vereinbaren war, bedurfte Europa
nach wie vor philosophischer und wissenschaftlicher Absi-
cherungen kolonialer Gewalt. Zum einen wurde die Behaup-
tung, dass Menschen in ›Rassen‹ unterteilt werden können,
in zum Teil neu etablierte wissenschaftliche Disziplinen wie
etwa die Phrenologie eingeschrieben. Um koloniale Herr-
schaft ausüben zu können, war zudem, gemäß dem Credo
»Wissen ist Macht«, Zugang zu lokalemWissen kolonisierter
Räume unerlässlich. Dabei spielte auch botanisches, geologi-
sches und zoologisches Wissen eine Rolle. Für die Machtaus-
übung zentraler jedoch waren Kenntnisse lokaler Sprachen
und Religionen, politischer Strukturen und kultureller Werte
eine unverzichtbare Grundausstattung, welche die Völker-
kunde und Afrikanistik lieferten.
Historische Kontexte der Afrikastudien
Im Ergebnis dieser Geschichte kam es 1887 an der Berli-
ner Universität zur Gründung des Seminars für Orientali-
sche Sprachen, das sich auf Sprachen Afrikas konzentrierte
und zudem ›Völkerkunde‹ betrieb. Geschichtswissenschaf-
ten oder Literaturwissenschaften etwa kamen nahezu ein
Jahrhundert lang nicht vor, weil es nach herrschender Mei-
nung und nicht zuletzt der Hegels weder Geschichte noch
irgendetwas anderes Menschliches in Afrika gäbe, also auch
In der
der eigenen
Zukunft
Geschichte
|26|


















