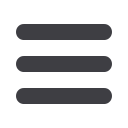

Spittler um neue Fächer wie etwa die Afrika-Literaturwis-
senschaft von Eckhard Breitinger und Janosz Riesz ergänzt.
Beier gründete 1981 das Iwalewahaus, das bis heute eine Brü-
cke zwischen Kunst und Universität schlägt.
Afrika (wissenschaftlich) neu erzählen
In jüngsten Debatten um die Zukunft des eigenen Fa-
ches wurde das Bayreuther Credo, in Kooperation mit
Kolleg*innen aus afrikanischen Ländern und ihren Diaspo-
ras zu forschen, um einen Perspektivwechsel hin zu Kriti-
schen Afrikastudien ergänzt. Dieses »kritisch« setzt bei einer
reflektierenden und verantwortlichen Reflexion der eigenen
Wissenschaftsgeschichte ein und unterzieht auf dieser Basis
den gesellschaftlichen Umgang mit Afrika einer Revision.
Konkret schließt das ein, noch immer vom Kolonialismus
eingefärbte Stereotype und Erzählungen über Afrika
und Schwarze Menschen in Deutschland zu hinterfragen.
Dabei geht es nicht nur darum, Kolonialismus kritisch zu
erinnern und Afrika als riesengroßen und sehr benachbar-
ten Kontinent zu erzählen, der ebenso divers wie spannend
ist und über Malls, Wolkenkratzer und Breitbrandkabel ver-
fügt, die das Internet schneller machen als etwa in Bayreuth-
Destuben. Es geht auch darum, politische, ökonomische und
kulturelle Prozesse in afrikanischen Ländern in ihren globa-
len Herkünften und Auswirkungen wissenschaftlich einzu-
ordnen. Das schließt ein, gemeinsame Zukünfte und deren
Ressourcen gerechter zu teilen und gegenwärtige Herausfor-
derungen verantwortlich zu meistern – ganz im Sinne von
Angela Merkels »Wir schaffen das!«
Die Kritischen Afrikastudien können weit in die Gesellschaft,
aber auch in die deutsche Wissenschaftslandschaft hinein
ausstrahlen – und dabei alte Binarismen wie etwa Regio-
nalstudien versus systematische Wissenschaft überwinden.
Zum einen arbeiten die Afrikastudien natürlich selbst sys-
tematisch, sind sie doch in theoretischen und methodischen
Debatten und deren jeweiligen Forschungsständen verankert.
Zum anderen arbeiten alle (systematischen) Wissenschaften
mit empirischen Schwerpunkten, die zum Teil regional ver-
ortet sind. Afrikanische Räume hier integrativer zu denken,
von Jura bis Anglistik, bietet die Möglichkeit, afrikanische
Wissensarchive aus allen Bereichen von Leben und Wissen
sinnvoll in ganzheitliche akademische Kontexte einzubringen
und gesellschaftliche, politische und kulturelle Prozesse in
aller Welt neu zu denken. Ob das Fach dann noch Afrikastu-
dien heißen kann oder weniger pauschalisiert forschen wird,
sei dahin gestellt. In jedem Fall wird es in einer anderen
Zukunft angekommen sein als der seiner eigenen Geschichte.
keine Literatur. Beides sei an Schriftsprache und ›Zivilisa
tion‹ gebunden. Nicht nur blieben in dieser weißen Per-
spektive bestehende schriftsprachliche Literaturen ignoriert.
Oralliteratur als ästhetisches Wissensarchiv wurde schon gar
nicht zur Kenntnis genommen.
Auch nachdem Deutschland seine Kolonien infolge des Ers-
ten Weltkrieges an andere europäische Kolonialmächte ver-
loren hatte, blieb die deutsche Kolonialsehnsucht bestehen.
Hitler vertrat dann offensiv die Vision, durch die Unterwer-
fung von Europa auch die europäischen Kolonien wieder
in deutschen Besitz zu bringen. Auch darüber hinaus sind
Nationalsozialismus und Shoa strukturell und ideologisch
mit der Kolonialgeschichte verschränkt. Auch die deut-
sche Afrikanistik behielt ihre koloniale Agenda samt der
Ausrichtung auf Sprachwissenschaft und Völkerkunde bei.
Sogar nach 1945 gab es diesbezüglich Kontinuitäten, übri-
gens in West und Ost: Ernst Damman arbeitete während des
Nationalsozialismus am Hamburger Seminar für Afrikani-
sche und Südsee-Sprachen und war Landesgruppenleiter der
Auslandsorganistaion der NSDAP. Ab 1949 war er zunächst
Professor in Hamburg. 1957 berief ihn die Ost-Berliner Hum-
boldt-Universität.
Neuorientierung der Afrika-Wissenschaften
Im Zuge der antikolonialen Freiheitsbewegungen und des
Kalten Krieges (der gerade auch in Afrika ›heiß‹ geführt
wurde) kam es in den 1960er-Jahren zu einer neuen, inten-
sivierten und vor allem auch reflektierteren Beschäftigung
mit Afrika. Dies ging mit einer beginnenden wissenschaft-
lichen Aufarbeitung der Kolonialgeschichte sowie einer Öff-
nung für neue Fächer einher. Hierzu zählt u. a. die Afrika-
Literaturwissenschaft.
Unter dem Eindruck der 1947 in Paris erfolgten Grün-
dung der Zeitschrift Présence Africaine, die das wichtigs-
te Sprachrohr für frankophone Intellektuelle wie Leopold
Sédar Sengor und Aime Césaire wurde, gründeten der Pri-
vatgelehrte Janheinz Jahn aus Frankfurt am Main und der
Kunstsammler und -kenner Ulli Beier aus Bayreuth 1957 die
Zeitschrift »Black Orpheus«, die als Pendant für den anglo-
phonen Raum konzipiert worden war. Nach dem Ausschei-
den von Jahn wurde »Black Orpheus« u. a. von dem späte-
ren Literaturnobelpreisträger und heutigem Ehrendoktor der
Universität Bayreuth, Wole Soyinka, mitgetragen.
Die Afrika-Studien an der Universität Bayreuth
Seit ihrer Gründung im Jahr 1971 baut die Universität Bay-
reuth so konsequent und nachhaltig wie keine andere euro-
päische Universität Forschungsverbünde auf, die sich mit
sozialen, kulturellen, künstlerischen, politischen, biologi-
schen, geologischen und soziologischen Aspekten des größ-
ten Erdenkontinentes beschäftigen. In diesem Klima wur-
de die Afrikanologie (als Bayreuther Bezeichnung für die
Linguistik) um Gudrun Miehe und die Ethnologie um Gerd
Professorin Dr. Susan Arndt
lehrt Transkulturelle Anglistik
in Bayreuth.
Der Afrikaschwerpunkt der Universität Bayreuth
Das seit 1990 bestehende Institut für Afrikastudien (IAS)
fördert und koordiniert die Afrikastudien von 12 Fächergrup-
pen der Universität Bayreuth, die sich auf alle sechs Fakul-
täten verteilen. Dieses breite Fächerspektrum wissenschaft
licher Afrikastudien ist einzigartig im deutschsprachigen
Raum.
|27 |


















