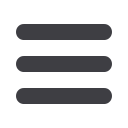

|38|
aviso 2 | 2016
FREMDE, IN DER FREMDE
WERKSTATT
Text:
Axel Monte
VON JUDEN, NEGERN UND ÜBERSETZERN
POLITICAL CORRECTNESS ODER
KULTURELLE HÖFLICHKEIT ALS GRATWANDERUNG
ALS DER OETINGER VERLAG
sich 2009 entschloss, in neuen
Auflagen von
Pippi Langstrumpf
einWort wie »Negerkönig«
durch »Südseekönig« zu ersetzen, löste die Frage, wie das
zu beurteilen sei, eine Diskussion aus, deren Aufgeregtheit
erstaunen lässt. Sehr häufig standen sich die Vertreter zweier
extremer Positionen gegenüber. Zum einen die Ideologen einer
Political Correctness, zum anderen jene, die aus einem Res
sentiment heraus gerade die politisch Korrekten mit Häme
überziehen und für die ein guter Mensch (»Gutmensch«)
etwas Verachtenswertes ist. Da allein schon der Begriff »Poli
tical Correctness« so ein rotes Tuch zu sein scheint, sollte man
vielleicht lieber wie Elmar Holenstein von »Cultural Polite
ness« sprechen. In seinem Artikel »Kulturelle Höflichkeit«
schreibt er: »Es gibt im Deutschen noch eine ganze Reihe
abschätziger ethnischer Bezeichnungen, die sich nicht gerade
vornehm anhören, weder für diejenigen, auf die sie angewandt
werden, noch für diejenigen, die sie verwenden. Anstelle von
Hottentotten
und
Buschmännern
hat sich in der angloame
rikanisch dominierten wissenschaftlichen Literatur
Khoisan
durchgesetzt.« Und vergessen wir nicht, dass sich vieles still
und leise imLaufe der Zeit von selbst erledigt. So ist das Wort
»Australneger« inzwischen aus unserem Sprachgebrauch so
gut wie verschwunden und die Bezeichnung »Aboriginies«
für uns normal geworden, ohne dass sich irgendjemand groß
darüber aufgeregt hätte.
Fagin zum Ersten
Ich muss gestehen, die Diskussion nur am Rande verfolgt zu
haben, als ich um diese Zeit herum für die Reclam Biblio
thek an einer Neuübersetzung von
Oliver Twist
arbeitete. In
Dickens’ Roman ist es nun kein Neger, über denman stolpert,
sondern ein Jude. Nicht weil er Jude ist, stolpert man, son
dern wegen der Art und Weise, wie er als solcher charakteri
siert wird. Schon der erste Auftritt des Schurken Fagin gerät
wenig schmeichelhaft, antisemitische Stereotypen (verfilzte
Haare, kaftanartiges Gewand) klingen bei der Beschreibung
durch und werden nachdrücklich verstärkt durch die dazuge
hörige Illustration von George Cruikshank, auf der auch die
angeblich »typische jüdische« Nase zu sehen ist: »In einer
Bratpfanne, die mit einer Schnur am Kaminsims befestigt
war, brutzelten über demFeuer ein paar Würstchen, und dar
über gebeugt stand, mit einer Röstgabel in der Hand, ein sehr
alter runzliger Jude, dessen abstoßendes Schurkengesicht
hinter einem Gewirr verfilzter roter Haare verschwand. Er
war mit einem schmierigen Flanellgewand ohne Kragen
bekleidet und schien seine Aufmerksamkeit zwischen der Brat
pfanne und einemWäscheständer, an dem eine große Anzahl
seidener Schnupftücher hing, zu teilen.« Sein Kumpan, der
brutale Einbrecher Bill Sikes, zeichnet dann etwas später in
wenigen Sätzen ein unmissverständliches Bild von Fagins
Charakter: »›He, was zum Teufel ist hier los?‹ knurrte eine
tiefe Stimme. ›Wer schmeißt da nach mir? Zum Glück hab
ich nur das Bier und nich den Krug abgekriegt, sonst hätt
ich jetzt jemand vertrimmt. Hätt ich ja wissen können, dass
nur’n verfluchter, reicher, diebischer und verlogener alter Jude
sich leisten kann, auch’n anderes Getränk als Wasser weg
zuschütten, wo er obendrein seine Wasserrechnung eh nie
bezahlt.‹« Und kurz darauf fährt Sikes fort: »›Was treibst
du hier? Die Jungs piesacken, du lüsterner, habgieriger, un-
er-sätt-li-cher alter Hehler?‹, sagte der Mann und setzte sich
gemächlich hin.«
DAS NAHM ICH
zum Anlass, mich ein wenig mit Dickens’
Verhältnis zu den Juden und mit der diesbezüglichen
Rezeptionsgeschichte von
Oliver Twist
zu beschäftigen und
imNachwort zu schreiben: »Geradezu erschreckend auf den
heutigen Leser wirken die antisemitischen Stereotype, die
Dickens verwendet hat, um möglichst nachdrücklich die
Gestalt eines ›stage jew‹, eines Bühnenjuden, zu zeichnen, etwa
nach Art des Shakespeareschen Shylock.« Zudem zeige ich die
Veränderung auf, die Dickens’ Haltung bei seiner Darstellung
von Juden erfährt, von einer unbewussten, in der damaligen
Zeit fraglos akzeptierten negativen, zu einer bewussten, für
die Problematik sensibilisiertenHaltung. Dabei erläutere ich
zugleichmeine Entscheidung, in der Übersetzung auf die Cha
rakterisierung einer Person als »Jude« zu verzichten: »Als in
den Jahren 1867/68 eine neue Ausgabe seiner Werke erscheint,
streicht Dickens in
Oliver Twist
an zahlreichen Stellen das
Wort ›Jude‹ und ersetzt es durch ›Fagin‹. Auch in den Texten,
die er für seine berühmten szenischen Lesungen bearbeitet
hat, fungiert Fagin lediglich als ›Hehler‹.
Die vorliegende Übersetzung, die sich ansonsten nach der
Ausgabe von 1846 richtet, der letzten, die Dickens grundle
gend überarbeitet hat und die daher als die maßgebliche gilt,
folgt ihm in dieser späteren Streichung und verzichtet kom
plett auf die Charakterisierung einer Person als Jude, ohne
dass dadurch das Verständnis der Geschichte im geringsten
beeinträchtigt würde. Hierin liegt auch der entscheidende
Unterschied zu Mark Twains
Huckleberry Finn
, von dem
immer wieder einmal Ausgaben erscheinen, in denen dasWort
›Nigger‹ getilgt wurde. In
Huckleberry Finn
ist Rassismus
jedoch eines der zentralen Themen, während das Thema Anti
semitismus in
Oliver Twist
keinerlei Rolle spielt. Neben Fagin
sind von dieser Änderung noch der Wirtsbursche Barney und
ein namenloser Kleidertrödler betroffen. Der Grund dafür
liegt keinesfalls in einer ideologischen Political Correctness,


















