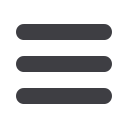

48
Einsichten und Perspektiven 4 | 17
genauswahl vorgeworfen.
17
Auch in den folgenden Wochen
dominierte die Flüchtlingssituation die Wahlkampf-Agen-
da.
18
Zeitgleich mit diesem thematischen Wendepunkt
begann auch der Abwärtstrend der Union in den Umfra-
gen. Aus der Perspektive der Demoskopie mündete die
Bundestagswahl „nach einer längeren ruhigen Phase doch
noch in ein dynamisches Finale“.
19
So öffnete sich in der
heißen Phase der Vorhang für die kleineren Parteien. Hier
stachen vor allem die AfD mit ihrer vieldiskutierten Nega-
tivkampagne und die jugendlich und „hip“ anmutende
FDP-Kampagne hervor. Trotz all dieser „Kipp-Punkte“
konnte der Wahlkampf 2017 – gerade unter dem Eindruck
der immer wirkmächtigeren Umfragedaten – kaum Dyna-
mik entwickeln. Martin Schulz kämpfte als Kanzlerkandi-
dat ohne Machtoption allein auf weiter Flur, aber auch die
kleineren Parteien waren ohne Koalitionsaussage auf ein-
samen Posten. Nicht zuletzt die Journalisten verfielen der
Wirkkraft der Demoskopie, indem sie sich früh auf den
Ausgang der Wahl festlegten.
Digitaler, populistischer, polarisierter und politisierter
Der Wahlkampf im Internet wird immer wichtiger.
Immerhin ist das Internet zu einem der wichtigsten Infor-
mationsmärkte für Wähler geworden. Parteien haben in
digitalen Kampagnen lange Zeit vor allem kostengünstige
Werbemöglichkeiten gesehen.
20
Trotz der Obama-Euphorie
nach 2009 sind Online-Wahlkämpfe in Deutschland zwar
zum integrierten Bestandteil der Kampagnen geworden, sie
wirkten aber bisweilen aufgesetzt und waren ineffizient.
21
Das Wahljahr 2017 muss in dieser Hinsicht anders bewertet
werden, stand es doch ganz im Zeichen der Digitalisierung.
Die Kampagne der FDP, mit der die Partei in „Start-Up-
Manier“ zum Comeback kam, spielte gezielt mit Online-
Trends und machte Digitalisierung sogar zum zentralen
17 Vgl. Stefan Koldehoff: „Das journalistische Resultat war unterdurchschnitt-
lich“, Interview mit Volker Lilienthal,
Deutschlandfunk.dev. 04.09.2017, ab-
rufbar unter:
http://www.deutschlandfunk.de/moderatoren-beim-tv-duell-das-journalistische-resultat-war.2907.de.html?dram:article_id=395054
[Stand: 18.09.2017]; Kathleen Hildebrand: Die Angst der Moderatoren vor
dem Mob,
Sueddeutsche.dev. 04.09.2017, abrufbar unter: http://www.
sueddeutsche.de/medien/tv-duell-die-angst-der-moderatoren-vor-dem-mob-1.3652046 [Stand: 18.09.2017].
18 Vgl. Thomas Petersen: Nur scheinbar ruhig. Unterschiede zwischen den
Wahlkämpfen 2013 und 2017, in: Die politische Meinung 62/2017, H.
546, S. 99-102, hier S. 102.
19 Petersen (wie Anm. 18), S. 100.
20 Vgl. zu Online-Wahlkämpfen Frank Brettschneider: Wahlkampf: Funktio-
nen, Instrumente und Fake News, in: Bürger & Staat 67 7/2017, H. 2, S.
146-153, hier S. 150 f.
21 Vgl. Bianchi/Korte (wie Anm. 1), S. 301 f.
Thema. Damit schaffte es die Partei in bisher ungekannter
Art mit den Stilmitteln der digitalen Welt erfolgreich auf
Stimmenfang zu gehen. Auf der anderen Seite trat mit der
AfD eine Partei zur Wahl an, deren Strukturen teilweise
in digitalen Milieus gewachsen sind und deren Politikver-
mittlung erfolgreich auf die direkte Kommunikation über
Social Media setzt. Hier zeigt sich der Vorteil einer Partei,
die mit dem Internet aufgewachsen ist und relativ geschlos-
sene digitale Milieus anspricht, die bereits vor der Parteig-
ründung entstanden sind und sich zu einer starken Sympa-
thisanten-Basis entwickelten. Sie setzte sich im Wahlkampf
damit quasi „ins gemachte Netz“. An diesen Beispielen zeigt
sich, dass sich das Beziehungsgeflecht zwischen Wählern,
Parteien und Massenmedien verschoben hat und die direkte
Kommunikation über soziale Netzwerke den Parteien neue
Möglichkeiten bietet.
22
Die Massenkommunikation vor-
bei an klassischen „Gatekeepern“ wie der Presse verändert
aber die Gestalt von Öffentlichkeit und setzten sie unter
Druck. Wie bei keiner anderen Wahl zuvor wurden daher
auch die Gefahren des digitalen Strukturwandels diskutiert.
Die Fragmentierung der Öffentlichkeit in Echokammern,
Fake News als gezielte und ideologisch unterfütterte Falsch-
meldungen oder unter Manipulationsverdacht stehendes
Microtargeting
wurden gerade angesichts der Erfahrungen
aus der amerikanischen Präsidentschaftswahl als Bedrohung
wahrgenommen.
In Erscheinung traten diese auch im Zusammenhang
mit Populismus diskutierten Phänomene bei der Bundes-
tagswahl nur teilweise. Trotzdem stand der Bundestags-
wahlkampf 2017 im Zeichen eines veränderten politischen
Klimas. Die Kampagne der AfD setzte klar auf Stilmittel
des „Negative Campaigning“, was in Deutschland bisher
als verpönt galt.
23
Mit einem „Anti-Merkel-Wahlkampf“,
gezielten Provokationen, einem scharfen Ton und deutli-
cher Eliten-Kritik konnten die Rechtspopulisten bei ihrer
Wählerklientel punkten und sorgten zeitgleich bei ihren
politischen Kontrahenten sowie Medien für Irritationen
und Gegenreaktionen – die der AfD wiederum mehr Auf-
merksamkeit verschafften.
24
Auf der Seite der Wählerschaft
führte sich der 2013 begonnene Trend einer stärkeren
Polarisierung fort.
25
Ganz im Gegensatz zur Bundestags-
wahl 2013 beschäftigten sich die Bürger aber auch deutlich
22 Vgl. Brettschneider (wie Anm. 20).
23 Vgl. Viola Neu: Wahljahr der Wendungen. Eine erste Einordnung, in:
Die politische Meinung 62/2017, H. 546, S. 89-92, hier S. 91.
24 Vgl. ebd.; vgl. Gäbler (wie Anm. 5).
25 Vgl. Neu (wie Anm. 23), S. 91.
Wahlnachlese 2017


















