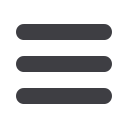

54
Einsichten und Perspektiven 4 | 17
tei
47
und ihr Institutionalisierungsprozess, bevor sie in das
nationale Parlamente eintrat?
Vor dem Hintergrund, dass die Institutionalisierung
einer neuen Partei im stabilen nationalen Parteiensystem
Deutschlands nach 1980 nur zweimal erfolgreich gelang
(Bündnis 90/Die Grünen; Die Linke), erscheint der Blick
auf den Institutionalisierungsprozess der AfD besonders
interessant. Denn viele junge deutsche Parteien wie die
Piratenpartei zerbrachen an innerorganisationalen Prob-
lemen, an Faktionalismus oder mangelnder Verankerung
in der Gesellschaft; die AfD hingegen überstand bislang
zunächst selbst das Zerwürfnis mit Parteimitbegründer
Bernd Lucke im Jahr 2015. Deutlich schneller und auch
deutlich erfolgreicher als noch die Piraten, konnte sich
die Partei als Akteur auf der nationalen politischen Bühne
positionieren.
Die Parteieninstitutionalisierungsforschung zeigt, dass
dieser Moment im Lebenszyklus einer Partei
48
– der Ein-
tritt in ein nationales Parlament – besondere Anforderun-
gen an junge Parteien stellt (sei es in organisatorischer,
personeller, programmatischer oder kommunikativer
Hinsicht).
49
Der Genese und den Institutionalisierungs-
schritten im Vorfeld des Eintritts in das nationale Parla-
ment wird für das Standhalten dieser Anforderungen und
für den weiteren Erfolg der Partei (im Sinne von Wettbe-
werbsfähigkeit) besondere Bedeutung zugesprochen.
50
Vor
allem objektive Aspekte wie die Organisationsausbildung
der Partei (auch auf untergeordneten Ebenen), interne
Aspekte der Institutionalisierung wie die Routinisierung
von Entscheidungsstrukturen und -prozessen, sowie
externe Aspekte wie die Wahrnehmung der Partei durch
Dritte und die Verankerung der Partei in der Gesellschaft
entscheiden darüber, ob eine neue Partei sich etabliert.
Zwar hat die AfD diese Dimensionen der Institutio-
nalisierung bislang nicht in gleichem Maße ausgebildet,
47 Vgl. Angelo Panebianco: Political Parties. Organization and Power, Cam-
bridge 1988.
48 Vgl. Mogens N. Pedersen: Towards a New Typology of Party Lifespans and
Minor Parties, in: Scandinavian Political Studies 5, 1/1982, S. 1–16. vgl.
ders.: The Birth, the Life, and the Death of Small Parties in Danish Politics.
An Application of the Lifespan Model, in: Ferdinand Müller-Rommel (Hg.):
Small parties in Western Europe. Comparative and national perspectives,
London 1991, S. 95–115.
49 Vgl. Nicole Bolleyer: New Parties in Old Party Systems. Persistence and
Decline in Seventeen Democracies, Oxford 2013.; vgl. Nicole Bolleyer/Eve-
lyn Bytzek: New party performance after breakthrough, in: Party Politics
23/2016, H. 6, S. 772–782.; vgl. Lefkofridi/Weissenbach (wie Anm. 32).
50 Vgl. Panebianco (wie Anm. 47); vgl. Kristina Weissenbach: Political party
assistance in transition. The German ‘Stiftungen’ in sub-Saharan Africa,
in: Democratization 17, 6/2010, S. 1225–1249; vgl. David Arter: When
new party X has the ‘X factor’, in: Party Politics 22, 1/2014, S. 15–26.
dennoch befindet sich die Partei trotz ihres jungen Alters
in einem fortgeschrittenen Institutionalisierungsstadium.
So gründete sich die Alternative für Deutschland,
gemäß der vergleichsweise hohen formalen Gründungs-
anforderungen in Deutschland,
51
zwar als komplett neue
Partei, folgte dabei aber dem Prinzip der Diffusion. Das
heißt, sie generierte ihre personellen und materiellen Res-
sourcen seit dem Jahr 2010 aus verschiedenen Vorläu-
fern und Sammlungsbewegungen rund um den Verein
„Wahlalternative 2013“ von Bernd Lucke und Konrad
Adam. Auf dem Gründungsparteitag am 14. April 2013
wurden Personen und Programmatik (vor allem der wirt-
schaftsliberale und eurokritische Kurs) des Vereins in die
Parteistruktur der Alternative für Deutschland überführt.
Parteien, die bei ihrer Gründung eher der Diffusion und
Bottom-up-Prozessen folgen, tendieren dazu schwach
ausgeprägte Organisationsstrukturen zu entwickeln, die
häufig durch konkurrierende Gruppen geprägt sind.
52
Dieser theoretische Befund aus der Parteienforschung
spiegelt sich in den empirischen Eindrücken der Genese
und Institutionalisierung der AfD wieder: Mit der Grün-
dung der sechzehn Landesverbände zwischen März und
Mai 2013 gelang zwar in einigen Bundesländern ein gere-
gelter Aufbau, in anderen kam es jedoch rasch zu inter-
nen Konflikten.
53
Diesem genetischen Weg folgend, hat
die AfD zunächst die Veranlagung zu einer schwach ins-
titutionalisierten Organisation, die Sammlungsbecken
für viele heterogene Gruppierungen ist, nur schwierig
geschlossen auftreten kann und personelle wie program-
matische Spaltungstendenzen aufweist. Dem entspricht
die Entwicklung der Partei seit den Landtagswahlen
2014: starke innerparteiliche Auseinandersetzungen und
Führungskonflikte (zunächst v.a. zwischen Bernd Lucke
51 Die Anmeldung einer neuen Partei beim Bundeswahlleiter setzt auch im
europäischen Vergleich hohe Standards voraus. Eine gefestigte Organisati-
on ist Bedingung, es muss eine Satzung und ein Parteiprogramm vorhan-
den sein. Aufgrund dessen sind deutsche Parteien bereits in einem frühen
Stadium naturgemäß formal stärker organisiert als beispielsweise Parteien
in jungen Demokratien, vgl. Weissenbach (wie Anm. 50), S.1232 f.
52 Dem entgegen steht das Prinzip der „
penetration
“ (Panebianco wie Anm.
47), d.h. der eher zentrale Organisationsaufbau einer neuen Partei von
oben nach unten, der in der Regel zunächst zu einer starken Organisati-
onsstruktur führt. Eine kohärent auftretende Parteielite ist hier von Be-
ginn an fähig, Entscheidungsprozesse zu initiieren und zu steuern; vgl.
ebd., S. 63.
53 Vgl. Alexander Häusler (Hg.): Die Alternative für Deutschland. Program-
matik, Entwicklung und politische Verortung, Wiesbaden 2016.; vgl.
Anne Böhmer/Kristina Weissenbach: Gekommen um zu bleiben? Zum
Zusammenhang des Institutionalisierungsprozess der AfD und ihren Er-
folgschancen nach der Bundestagswahl 2017, in: Karl-Rudolf Korte/Jan
Schoofs (Hg.): Die Bundestagswahl 2017. Analysen der Wahl-, Parteien-,
Kommunikations- und Regierungsforschung, Wiesbaden 2018 (i.E.).
Wahlnachlese 2017


















