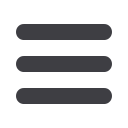

|42|
aviso 2 | 2016
FREMDE, IN DER FREMDE
WERKSTATT
Fagin!
Dies ist mein
Freund
Oliver …
Er ist unser neu-
er Kumpane!
Ahhh
Willkommen,
willkommen,
willkommen!
Hier, mein
Jungchen, iss, so
viel du willst! …
Das wird dir den
Magen wärmen.
Hier … Fagin!
Das ham wir
heute „einge-
sackt”.
Ho Ho Ho! …
Da habt ihr wirklich
gute Arbeit geleistet
… Jungs!
Da
zahlste
uns gut
für, was?!
Aber klar, ihr braven
Jungs … Das mach ich
doch immer, oder? Hier …
hier!
Und jetzt gehst
du bei uns in die Lehre,
mein kleiner Oliver!
Pass gut auf, Junge
… ja!!
72
001-144_5521_1A_EGN_ICH_BIN_FAGIN.IND7 72
07.07.15 16:01
fach, dass der Schurke Fagin ein Jude ist, sie möchten, das
er jiddelt, sie suchen darin das »Tümelnde«, was ihnen –
warum auch immer – ein behagliches Gefühl verschafft. So
bewirbt zum Beispiel der Hörbuchverlag 123Classic seine
Oliver Twist
-Ausgabe wie folgt: »Bei den Übersetzungen des
Werkes aus dem Englischen gibt es deutliche Unterschiede.
Als die wahrscheinlich beste Übersetzung gilt die von Gustav
Meyrink, welche die Vorlage für das Hörbuch lieferte. Die ›alte‹
Sprache des 1868 in Wien geborenen Meyrinks erweckt die
Zeit des Manchester Kapitalismus, in der
Oliver Twist
spielt,
wieder zum Leben. Besonderen Charakter haucht Meyrink
den Protagonisten zudem ein, indem er ihnen in den Dia
logen verschiedene Dialekte zuweist. Für den Schauspieler
und Sprecher Frank Stöckle ist der Roman eine Fundgrube
für sprachliche Finessen: Seine feinen Interpretationen der
meyrink‘schen Dialekte verleihen den Romanfiguren Indivi
dualität, Charme und Sprachwitz.«
ENTSPRECHEND WIRD DIES
von den Lesern goutiert, wie
man einer Kundenrezension zur Meyrinkschen Übersetzung
in der Ausgabe von dtv bei Amazon entnehmen kann: »Was
mir vor allem gefallen hat war, dass die Textpassagenmancher
Personenmit Akzent geschrieben wurden und dem ganzen so
noch etwas mehr Atmosphäre geben. Besonders gut kommt
das meiner Meinung nach bei dem jiddischen Akzent von
Fagin (›dem Juden‹) rüber.« Zumindest eine Besprechung
macht eine Ausnahme, sie lobt ausdrücklich die »Dialekt
freiheit« meiner Neuübersetzung: »Wo vormalige deutsche
Übersetzungen hilflos hinter der Eleganz der Dickensschen
Formulierungen zurückbleiben und diese in gestelzte, um
Witzigkeit bemühte Ungetümer verwandelten (teilweise mit
grässlichem bayerischem Dialekt?!), stellt sich die neue, zeit
los anmutende Übersetzung als äußerst lesbar – mit großem
Suchtfaktor – und doch authentisch dar.« Die vierte Rezen
sion schließlich, die sich mit dem Thema auseinandersetzt,
wurde von einem Edwin Baumgartner verfasst und erschien
am23.12.2011 in der Wiener Zeitung. Betitelt ist sie mit »Der
verschwiegene Antisemitismus«. Wer daraus ableitet, im fol
genden Artikel würde aufklärerische Arbeit geleistet, um
bisher verborgene antisemitische Hetze aufzudecken, wird
jedoch enttäuscht werden. Tenor ist stattdessen das ebenso
abgedroschene wie verlogene »man wird doch wohl noch
sagen dürfen«. »Verlogen«, weil ja jeder sagen darf. Der Bei
trag behandelt zwar weitere Fälle antisemitischer Stellen bei
britischen Autoren (Christopher Marlow, William Shakes
peare, Oscar Wilde und Agatha Christie), aber Anlass und
Hauptstoßrichtung bildet meine damals gerade neu erschie
nene Neuübersetzung von
Oliver Twist
.
Das »verschwiegen« in der Überschrift ist schon deshalb
gelinde gesagt irreführend, da ich, soweit mir bekannt, der
erste Übersetzer bin, der sich explizit mit diesem Thema bei
Oliver Twist
auseinandergesetzt und das im Nachwort offen
dargelegt hat. Der Rezensent hat zudem eine recht einfältige
Vorstellung vom »korrekten« Übersetzen; das geht nämlich
so: »Übersetzen, was der Autor geschrieben hat. Was sonst?«
Die zahlreichen eklatant unterschiedlichen Übersetzungen
(nicht nur von Dickens) lassen sich mit solch schlichter Maxi
me, nach der es ja nur eine gültige eins zu eins Übersetzung
gäbe, freilich nicht in Übereinstimmung bringen. Das Urteil
der Wiener Zeitung lautet jedenfalls: »Solches Werk zu tun
steht einemÜbersetzer, auch nach Auschwitz, nicht zu.« Am
Ende der Rezension wird dann jedoch dieMeinungsfreiheit in
Großbritannien gepri sen, die sich auch auf zwielichtige Ge
stalten wie David Irving erstreckt. Diesem steht es also durch
aus zu – »auch nach Ausschwitz« –, denHolocaust zu leugnen.
Fagin zum Zweiten
Einige Jahre später folgte dann eine Art ironisches Nach
spiel. Während meiner Arbeit an
Oliver Twist
stieß ich auf
Will Eisners (1917-2005) Graphic Novel
Fagin the Jew
, worin
der Schurke die Geschichte aus seiner Sicht erzählt. Von die
sem Buch war ich so angetan, dass ich es gerne zugleich mit
Oliver Twist
auf Deutsch veröffentlicht hätte. So sehr ichmich
jedoch bemühte, ließ sich erst einmal kein Verlag dafür finden.
Ob es daran lag, dass es im Buch um Juden und Antisemitis
mus geht, vermag ich nicht zu sagen. Jedenfalls war meiner
Verlagssuche erst 2014 Erfolg beschieden. Die Übersetzung
erschien dann im September 2015 bei Egmont.
IN DIESEM FALL
ist der Antisemitismus eindeutig Thema
des Buches. Eisner hat sich in seinem Spätwerk darauf kon
zentriert, der Entstehung und Auswirkung von Antisemitis
mus und Vorurteilen nachzuforschen, neben
Fagin the Jew
(2003) auch in seinem letzten Werk
The Plot
(2005), in dem
es um die gefälschten Protokolle der Weisen von Zion geht.
Hier stand für mich also außer Frage, Bezeichnungen wie
Ausschnitt aus Will Eisner, Ich bin Fagin. Köln, 2015, mit freundlicher Genehmigung von Egmont Graphic Novel


















