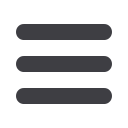

|40|
aviso 2 | 2016
FREMDE, IN DER FREMDE
WERKSTATT
Ich möchte nochmals betonen, dass es sich bei dieser Strei
chung nicht um eine oberflächliche Political-Correctness-Kos
metik handelt, sondern um etwas, das tief in unsere Sprache
und unser Bewusstsein hineinwirkt.
Sprache und Verantwortung
In ihrembemerkenswerten Buch
Mein weißer Frieden
, in dem
sich Marica Bodroži´c, deutsche Schriftstellerin kroatischer
Herkunft, mit den Kriegen während und nach der Auflösung
Jugoslawiens auseinandersetzt, beschäftigt sich die Autorin
ausführlich mit der Rolle, die Sprache als Propaganda- und
Herrschaftsinstrument spielt, und damit, was sie dabei an
richten kann. So erinnert Bodroži´c daran, dass die allerers
ten Granaten, die auf das tapfere und geschundene Sarajevo
fielen, »Sprachgranaten« waren und der feige Mord an dem
Idealisten Zoran Djindji´c »in einer hetzerisch-derben Spra
che schon lange vorbereitet« war. Bodroži´c bezieht sich bei
ihren Analysen immer wieder ausdrücklich auf Martin Buber
und den von ihm beschriebenen Zusammenhang zwischen
Sprache undMenschlichkeit. Bei Buber steht ein »sprachlich
zentrierter Humanismus« im Mittelpunkt, die »Ehrfurcht
vor demWort«. Das erfordert natürlich von jedem einen ver
antwortlichen Umgang mit der Sprache und den Versuch,
sich möglicher Folgen ihres Gebrauchs und Missbrauchs
bewusst zu werden. Man stelle sich zum Beispiel vor, was
die antisemitischen Phrasen des suggestiv sprachmächtigen
Dickens bewirken, wenn sie sich, vorgelesen, ins Bewusst
sein von Kindern regelrecht einfräsen, »weil der Antisemi
tismus durch den literarischen Genius verstärkt wird«. Was
für ein Bild wird sich da imGeiste festsetzen? Jeet Heer fasst
zusammen: »Der Jude ist schmutzig, der Jude ist ein Verbrecher,
der Jude ist ein Verderber der Kinder, der Jude schätzt Geld
höher als menschliche Beziehungen, der Jude steht mit Gift in
Verbindung, der Jude ist ein Verräter imStile Judas’, der Jude
ist ein Tier, der Jude ist ein Mörder, der Jude ist der Teufel.«
Dickens späteres Umdenken in seiner Haltung zur Verwendung
antisemitischer Klischees dürfte auchmit diesemWissen um
Verantwortung zu tun gehabt haben. Und unterschätze nur
niemand die Beständigkeit und Hartnäckigkeit bösartiger
Klischees. Als sichWill Eisner, der Nestor der Graphic Novel,
daranmachte, Material für seine Adaption von
Oliver Twists
Fagin the Jew
zu sammeln, fiel ihmFolgendes auf: »BeimSich
ten der Illustrationen der Originalausgabe von
Oliver Twist
fand ich unzweifelhafte Beispiele optischer Diffamierung in
der klassischen Literatur. Die Erinnerung an ihre schreckli
che Verwendung durch die Nazis imZweitenWeltkrieg ist ein
weiterer Beleg für die Langlebigkeit bösartiger Klischees.«
Die Meyrinksche Übersetzung
Bevor ich auf einige Rezensionen zu meiner Übersetzung ein
gehe, ist es angebracht, einen Blick auf die Twist-Übersetzung
von Gustav Meyrink zu werfen – die wohl nach wie vor mit
amweitesten verbreitet und allgemein wohlgelitten ist –, weil
in den Besprechungen immer wieder darauf Bezug genom
men wird. Meyrinks Übersetzung ist ursprünglich 1916 im
Albert Langen VerlagMünchen erschienen; inzwischen gibt es
davon aber mehrere Lizenzausgaben und vor allem auchHör
bücher. Der Übersetzer hat Dickens’ Text höchst eigenwillig
»gestrafft« und recht frei ins Deutsche übertragen. Auch bei
Meyrink betrifft die auffälligste Änderung gegenüber dem
Original Fagin. Sein Fagin jiddelt, was er bei Dickens mit
nichten tut, dort spricht er zumeist ein gepflegtes Englisch,
was ihn von seinen Kumpanen abhebt. Meyrinks Fagin da
gegen »jiddelt (wie der Übersetzer G. Meyrink Prager Juden
in seinem
Golem
jiddeln ließ) oder spricht in jüdisch idio
matischen Wendungen […]«, schreibt Dietmar Pertsch. Er
zitiert folgende Stelle als Beispiel: »›Weigeschrieen, Gott über
die Welt‹, jammerte Fagin, ›und was sagen denn Sie, Nancy
leben? Das is e Gerechtigkeit?‹«
BEI DICKENS HEISST
es dagegen so: »›This is hardly fair,
Bill, hardly fair, is it, Nancy?‹ inquired the Jew«, was ich wie
folgt übersetzt habe: »›Das ist kein ehrlich Spiel, Bill, kein
ehrlich Spiel, nicht wahr, Nancy?‹, sagte der alte Hehler.«
Die Umgangssprache der einfachen Leute und Ganoven wird
von Meyrink zuweilen – aber keineswegs durchgängig – mit
Dialektbrocken wiedergegeben. So berlinern Bill Sikes und
Nancy hin und wieder. Unter anderem heißt es bei Meyrink:
»›Det gloob ick ooch‹, erwiderte die junge Dame«, womit jede
Illusion, man befände sich im viktorianischen London, in sich
zusammenstürzen dürfte. ImOriginal steht dagegen schlicht
»›I should think not!‹ replied the young Lady«. Für die Ein
schätzung des Stellenwerts der Meyrinkschen Übersetzungen
ist vielleicht auch folgender Passus aus dem Eintrag in der
Neuen Deutschen Biographie
aufschlussreich: »M.s Traum,
frei von finanziellen Verpflichtungen, die seit dem Konkurs
in Prag auf ihm lasteten, zu leben, erfüllte sich trotz eines
monatlichen Fixums vom Verlag des ›Simplicissimus‹ nicht.
So übernahm er 1909 den Auftrag einer Dickens-Übersetzung,
die er in kurzer Zeit fertigstellte, indem er mit Hilfe eines Dik
tiergeräts (Parlograph) vom Blatt übersetzte.«
Reaktionen
Von den zweiundzwanzig Rezensionen oder Buchhinweisen,
die mir zumeiner Übersetzung bekannt sind, äußern sich die
allermeisten positiv zur Sprache und heben die Qualität von
Anmerkungen und Nachwort hervor. Jedoch gehen nur vier
auf die Problematik mit dem »Juden Fagin« ein.
Den Anfang machte Hannes Stein in DieWELT. Sein Bild von
der ethnisch-religiösen Kennzeichnung »Jude« als aufgemal
temSchnurrbart entspricht ziemlich genaumeiner Äußerung
imNachwort, dass das Verständnis der Geschichte durch die
Streichung nicht im Geringsten beeinträchtigt würde. Stein
schreibt: »Die Übersetzung von Axel Monte ist schön und
zuverlässig, er trifft den ironisch-sarkastischen Ton genau.
Bemerkenswert ist seine deutsche Nachschöpfung aber auch
aus folgendemGrund: Dickens hat mit Fagin eine der großen
antisemitischen Figuren der englischen Literatur geschaf
fen, ein veritables Monster. (Die andere große antisemitische
001-144_5521_1
Ausschnitt aus Will Eisner, Ich bin Fagin. Köln, 2015, mit freundlicher Genehmigung von Egmont Graphic Novel


















