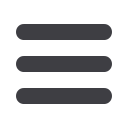

Die Interviews
30
Einsichten und Perspektiven Themenheft 1 | 15
wir waren aber zusammen in einer Art Vorbereitungslager.
Das Vorbereitungslager war in Wien, aber es wurden nicht
alle mitgenommen. Man hat ausgesucht, wen man mit-
nimmt; warum man uns ausgewählt hat und nicht einfach
alle Kinder mitgenommen hat, das weiß ich nicht.
Wir sind einen Tag mit der Eisenbahn gefahren und
dann sieben Tage mit dem Schiff. In Palästina wurden wir
dann in ein Kinderheim in der Nähe von Haifa gebracht
und ich war dort ungefähr vier, fünf Jahre lang. Wir soll-
ten sofort aufhören, deutsch zu sprechen, um uns an die
neue Sprache zu gewöhnen. Wir haben das zwar nicht
unbedingt gemacht, aber die Betreuer haben viel hebrä-
isch mit uns geredet und so haben wir die Sprache gelernt.
Ich war mit einigen anderen Kindern auf einem Zimmer,
aber ich war nicht daran interessiert, bei anderen Kindern
zu sein, ich wollte bei meinen Eltern sein.
Die Eltern bleiben zurück
Meine Eltern haben mir noch bis 1942 Briefe geschrieben
und gesagt, dass sie nachkommen würden, aber danach
nicht mehr. Sie wurden in Wien in ein
Judenhaus
umge-
siedelt. Die Fluchthelfer haben von allen Familien zuerst
die Kinder verschickt, aber sie sind dann nicht mehr dazu
gekommen, meine Eltern zu schicken. Ich selbst konnte
nicht zurückschreiben. Ich bekam sogar einen Brief
von Verwandten, die schrieben, meine Eltern seien sehr
besorgt, weil ich nie zurückschrieb, aber es wurden keine
Briefe nach Deutschland zugelassen. Die Briefe habe ich
immer noch. Meine Eltern wurden verschleppt, ich habe
sie nie wieder gesehen. Das war eine sehr schwere Zeit für
mich, ich habe meine Eltern furchtbar vermisst. Ich habe
sie nie wieder gesehen, und ich war damals ja erst zwölf,
ich war so jung.
Krieg und Frieden in Israel
Auch in Israel haben wir die Auswirkungen des Krieges
mitbekommen. Zum Beispiel hatten wir in dem Kinder-
heim, in dem ich war, einen Bunker im Keller, in den wir
bei Luftangriffen gehen mussten. Später bin ich weg von
dort und habe als Haushälterin gearbeitet, damit ich Geld
sparen konnte, um bei einem Lehrerseminar mitzumachen.
Ich hatte ja niemanden, der mir das zahlen konnte. Ich gab
Unterricht in Hauswirtschaft und wurde schließlich stellver-
tretende Schuldirektorin. Ich wohnte lange Zeit in Haifa.
MeinenMann habe ich beimMilitär kennengelernt. Ich war
ja auch im Militär, als Funkerin. Mein Mann wurde in der
Bukowina geboren, er ist nach dem Krieg illegal nach Israel
gekommen. Mein Bruder war sehr lange in einem Kibbuz,
ich bin sehr oft auf Besuch gekommen, aber ich habe dort
nie gewohnt. Das hätte ich auch nicht wirklich gewollt.
Mit den Söhnen in Österreich
Ich war nach dem Krieg noch einmal in Österreich. Der
Bürgermeister von Wien wollte mich sogar einladen, aber
ich habe gesagt: „Wenn ich komme, dann komme ich allein.
Man braucht mich nicht einzuladen.“ Ich war dort mit mei-
nen Söhnen und habe ihnen gezeigt, wo ich früher gewohnt
habe, aber wir sind nicht in die Wohnung hinauf gegangen.
Aus Österreich vermisse ich vor allem die Wälder, die
Seen. Und Blaubeeren. Die gibt es hier nicht.
Protokoll: Sandra Lörentz, Rafael Schütz, Leonie Weißweiler
Jitzchak Bronstein: Ich kann es kaum ein
Leben nennen
Jitzchak Bronstein stieß als letzter Interviewpartner zu die-
sem Projekt. Da er im Januar 2013 noch nicht im Altenheim
wohnte, konnte er an der ersten Interviewrunde nicht teil-
nehmen. Als ein Teil unserer Gruppe aber erneut nach Ramat
Gan reiste, erfuhren wir von ihm, dass auch er sich gerne an
diesem Erinnerungsprojekt beteiligen wollte. Dieses Interview
wurde deshalb im Juli 2014 per Mail geführt.
Ich wurde am 11. Februar 1928 in Isky in der damali-
gen Tschechoslowakei, heute Ukraine, geboren. Meine
Kindheit verlief glücklich und friedlich, bis ich mein elftes
Lebensjahr erreicht hatte. Mit Beginn des Zweiten Welt-
krieges wurde ich mit Verfolgung und Ausgrenzung kon-
frontiert, aufgrund meines jüdischen Glaubens wurde ich
mit 18 Jahren 1944 schließlich in das Konzentrationslager
Mauthausen
in Österreich deportiert. Von dort aus kam
ich später in das in der Nähe gelegene
KZ Gusen.
Der Alltag im KZ bestand aus schwerster körperlicher
Arbeit: Zwölf Stunden täglich musste ich in Erd- und
Steinwerken schuften. Es mangelte zudem an Essen, Medi-
zin und Kleidung. Nach einigen Wochen unter diesen
Bedingungen verlor ich die Hoffnung auf eine Zukunft.
Es war die schwerste Zeit in meinem Leben. Man kann es
kaum ein Leben nennen.
Als am 4. Mai 1945 die Amerikaner die Häftlinge
befreiten, begab ich mich auf die Suche nach meinen


















