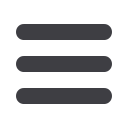
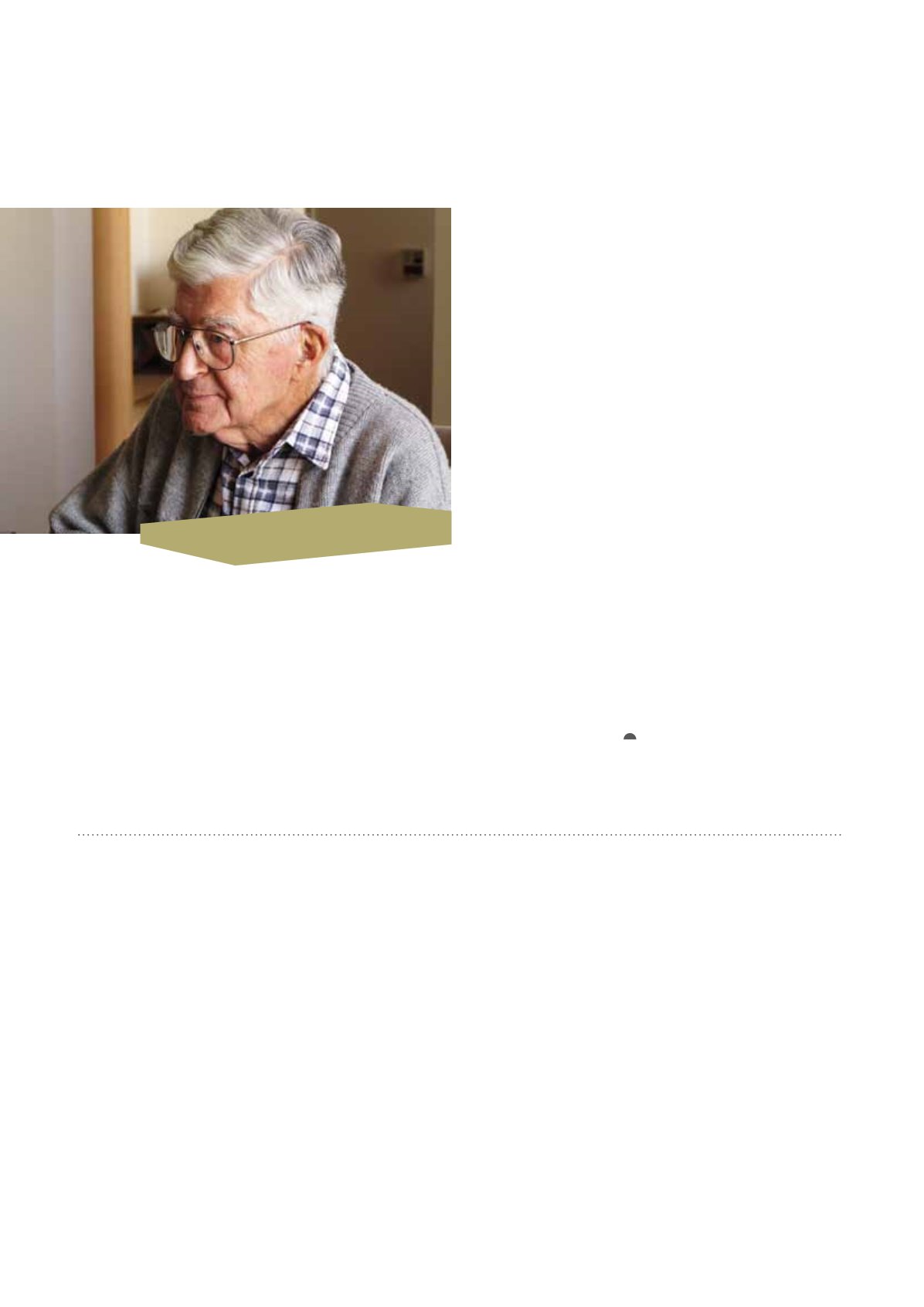
Die Interviews
26
Einsichten und Perspektiven Themenheft 1 | 15
später eine Arbeitsstelle in der Bibliothek in Tel Aviv ange-
nommen und hat dort bis zu ihrem 65. Lebensjahr gearbeitet.
Ich habe Tagebücher geschrieben, damit meine Enkel
Bescheid wissen
Gerade weil ihre Kinder und Enkelkinder wieder in Deutsch-
land leben und Familie Schütz auch des Öfteren in Deutsch-
land zu Besuch ist, ist es ihnen umso wichtiger, dass das
Geschehene weitererzählt wird.
Während meines ganzen Lebens habe ich Tagebücher
geschrieben, in denen ich alles niederschrieb, was ich erlebt
hatte. Meine Frau und ich denken, dass es sehr wichtig ist,
sich zu erinnern und nicht zu vergessen. Wir alle wissen,
was damals passiert ist, aber es gibt einen anderen Grund,
warum ich diese Tagebücher geschrieben habe, und zwar,
damit unsere Enkelkinder darüber Bescheid wissen, was
uns und unseren Familien damals passiert ist. Das ist näm-
lich eine Zeit, die man nicht vergessen soll. Auch wenn
es viele Menschen gibt, die sagen: „Das interessiert uns
nicht“ und „dagegen ist nichts zu tun“, interessiert es uns
aber sehr. Es ist wichtig, dass man über den Zweiten Welt-
krieg und den Holocaust nachdenkt.
Die Erinnerung hängt nicht von einem Ort ab
Wenn wir heutzutage in der Zeitung lesen, wieviel Geld
nötig ist, um Auschwitz zu restaurieren, dann denke ich,
dass das gar nicht so wichtig ist, weil wer das erlebt hat,
der braucht keine Erinnerung, und wenn jemand sich
dafür interessiert und nach Auschwitz geht und sieht, wie
es heute dort aussieht, der braucht auch keine Restaura-
tion, denn der möchte es so erleben, wie es war.
Warum wir uns erinnern sollten, hängt nicht von
einem Ort ab und ob er restauriert ist oder nicht, denn
wir gehen öfter zu Denkmälern und Gedenkstätten, ohne
ihre Bedeutung zu kennen und ohne über ihre Schönheit
nachzudenken. Wer sich also dafür interessiert, der achtet
nicht auf das Äußerliche, sondern findet einen Weg, sich
tiefer mit dem Gegenstand zu befassen und es zu verste-
hen. Das Wichtigste ist aber, dass er sich die Mühe macht,
das nicht zu vergessen.
Protokoll: Elisabeth Popov, Bianca Roth
Gabriel Schütz
Foto: Anja Schoeller
Rena Wiener: Ein Brot war eine Million wert
Bereits als Jugendliche verlor Rena Wiener Vater und Mut-
ter. Nach dem Krieg fand sie das Krematorium, in dem ihre
Mutter verbrannt worden war. Rena hatte einen Bruder
und zwei Schwestern. Ihr Bruder kam auf dem langen Weg
von Salzburg nach Theresienstadt ums Leben und ihre große
Schwester starb mit 23 Jahren im Ghetto an Tuberkulose.
Ihre andere Schwester war gegen Ende des Krieges die einzige
Familienangehörige, die Rena noch hatte. Aus dem Ghetto
in Lodz wurde Rena nach Auschwitz deportiert, von dort
musste sie nach Stutthof, ein KZ in der Nähe von Danzig
(heute Gdansk). Hier musste sie in einer Fabrik Zwangs-
arbeit leisten, bevor sie nach Dresden verschleppt wurde, von
dort später über Pirna nach Theresienstadt, wo sie in einem
Krankenhaus arbeitete. Nach der Befreiung machte sie in
Salzburg eine Ausbildung zur Krankenschwester und ging
anschließend nach Amerika, wo sie als Krankenschwester in
einem Kloster arbeitete. Nach zwölf Jahren in Amerika zog
sie nach Israel. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann ken-
nen. Rena Wiener ist inzwischen verstorben.
Die Männer haben sehr geschrien
Es war am 1. September 1939, daran kann ich mich
genau erinnern, da ist der Krieg ausgebrochen. Wir
haben kurze Zeit später bei
Lodz
zum ersten Mal deut-
sche Soldaten gesehen. Sie sind in die Wohnungen hin-
eingekommen und die Leute wussten nicht, was sie woll-
ten. Ich glaube, die Deutschen wussten auch nicht, was
sie wollten. Sie wollten uns nur schlecht machen, das war
klar. Von manchen Wohnungen haben sie Dinge gestoh-


















