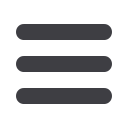
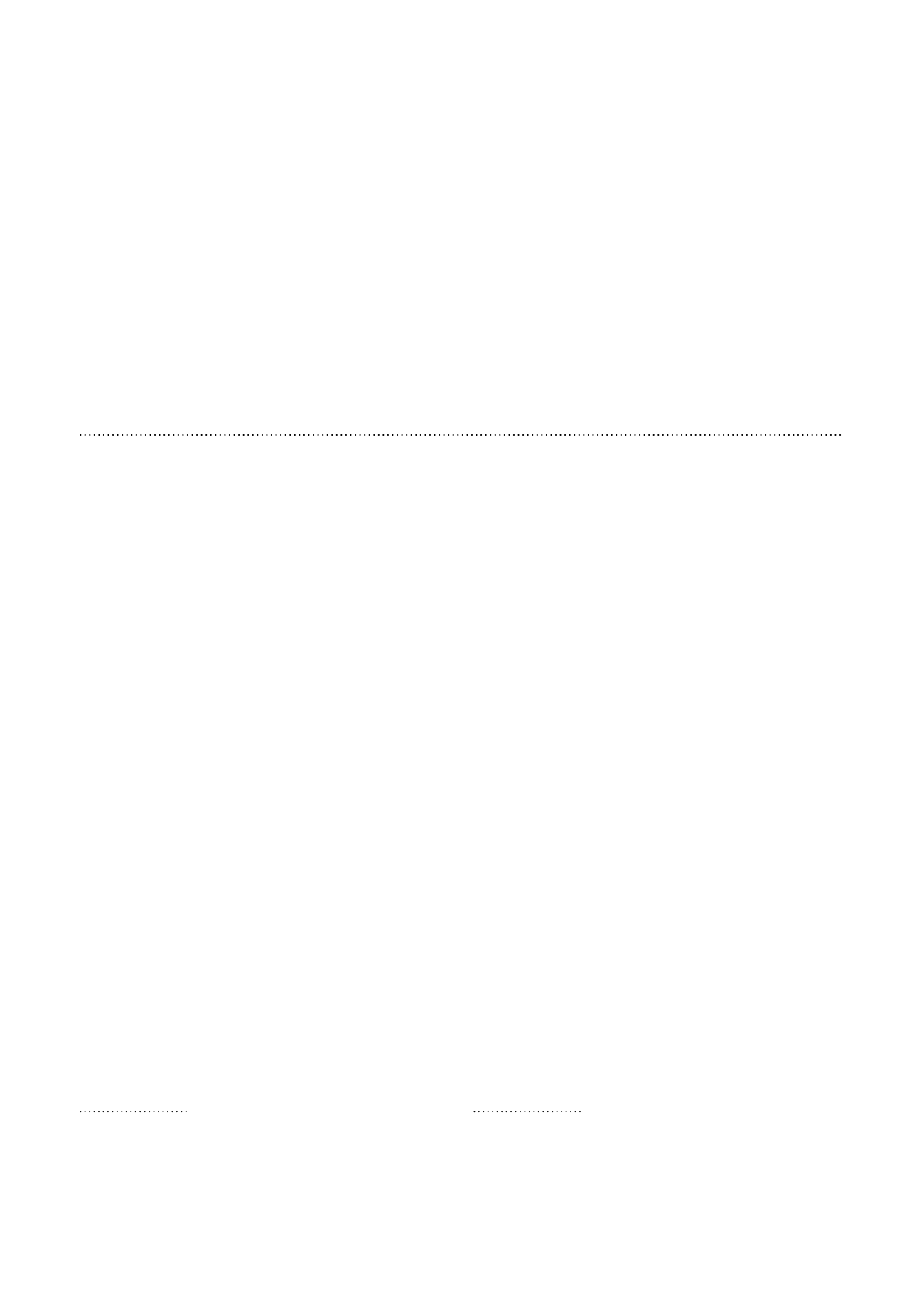
„Und du siehst, dass du alleine bist.“
38
Einsichten und Perspektiven Themenheft 1 | 15
„Und du siehst, dass du
alleine bist.“
4
Zu den Begegnungen zwischen jüdischen Überlebenden und deutschen Jugendlichen
von Gudrun Brockhaus
Mit Spannung, so die Initiatoren des Projektes, hätten sie
sich gefragt, ob ein Aufeinandertreffen von Holocaust-
Überlebenden mit deutschen Jugendlichen in einem isra-
elischen Altenheim „überhaupt funktionieren könne“ –
was immer man sich unter einem „funktionierenden“
Treffen vorstellen mag.
Und im Folgenden wird dann klarer, dass die Spannung
weniger eine neugierige Aufregung vor einer Reise in die
Fremde war. Vielmehr hatte die Aussicht auf das Treffen
zwischen den deutschen Gymnasiasten und den jüdischen,
deutschsprechenden Überlebenden in dem israelischen
Altenheim im Vorhinein „Bedenken“ und fast etwas wie
Angst ausgelöst. „Ist das machbar?“ Das hätten sich die
begleitenden Lehrer, die Eltern, Kollegen, Freunde, aber
auch die beteiligten Schülerinnen und Schüler gefragt –
funktioniert es, ist das machbar – was soll denn funktionie-
ren, machbar sein? Die technische Sprache überspielt viel-
leicht eine emotionale Unsicherheit und das Gefühl einer
drohenden „Überforderung“, die mit den Begegnungen
zwischen den Täternachfahren und den jüdischen Verfolg-
ten verbunden ist und die von den begleitenden Lehrern
schließlich offen als emotionale Belastung bezeichnet wird.
Ein Grund für diese Ängste ist, dass schon im Vorfeld klar
ist, die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus dem deutsch-
sprachigen Altenheim „würden uns dort von ihren erschre-
ckenden Erlebnissen während der Zeit des „Dritten Reichs“
4 So Leopold Yehuda Maimon über seinen ersten Tag in Krakau nach seiner
Flucht aus Auschwitz. Vollständig lautet das Zitat: „In Auschwitz lebst du
von einer Stunde zur zweiten. Aber es war der erste Tag und du bist frei.
Deine Stadt. Und du siehst, wie schrecklich die Lage ist. Dass du alleine
bist.“, vgl. S. 22.
erzählen“. Da die Interviews sich auf die Verfolgungserfah-
rungen in Deutschland konzentrieren sollen, ist von vorn-
herein klar, was man zu erwarten hat, rechnet man schon
mit dem eigenen Erschrecken. Aber es ist nicht nur der
vermutlich bedrückende Inhalt der Gespräche, der „ner-
vös“ macht, sondern mehr noch die zwischenmenschliche
Situation, die „schwierige Gesprächssituationen für beide
Gesprächsparteien“: „ein Aufeinandertreffen von Alt und
Jung, von Holocaust-Opfern und der dritten Generation
der ‚Täter‘“. Die Art der erwarteten Schwierigkeit deuten
die sprachlichen Formulierungen an: Es geht um „Parteien“,
die Formulierung „Aufeinandertreffen“ lässt an das Aufein-
anderprallen von zwei gegensätzlichen, ja antagonistischen
Welten denken. Es ist nicht einmal selbstverständlich zu
erwarten, dass die Nachfahren der Täter überhaupt zu
Gesprächspartnern werden: Nur zu gut würde man verste-
hen, wenn die jüdischen Holocaustüberlebenden überhaupt
nicht mit einem reden würden, man bangt, ob sie die eigene
Wertschätzung und den Respekt wahrnehmen werden.
5
Verunsicherung und Erschütterung ergreifen wohl
jeden, der mit den Opfern von Massakern und Massen-
vernichtung konfrontiert ist. Für die begleitenden Lehr-
kräfte Uschalt und Braune hatten die Verfolgungsberichte
eine Qualität, die „uns für immer im Gedächtnis bleiben“
wird. Die Berichte der Überlebenden, ihre sichtbaren und
spürbaren Wunden und Traumata rücken uns die gern
5 „Wie sollen wir in Israel auftreten? Wie sollen wir unsere Wertschätzung
zeigen, dass wir zu Besuch sein dürfen, unseren Respekt davor, dass uns
diese Geschichten erzählt werden? Wird man mit uns Deutschen spre-
chen? So würden wir es doch selbst zu gut verstehen, wenn man nicht mit
uns reden wollte.“


















