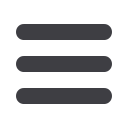
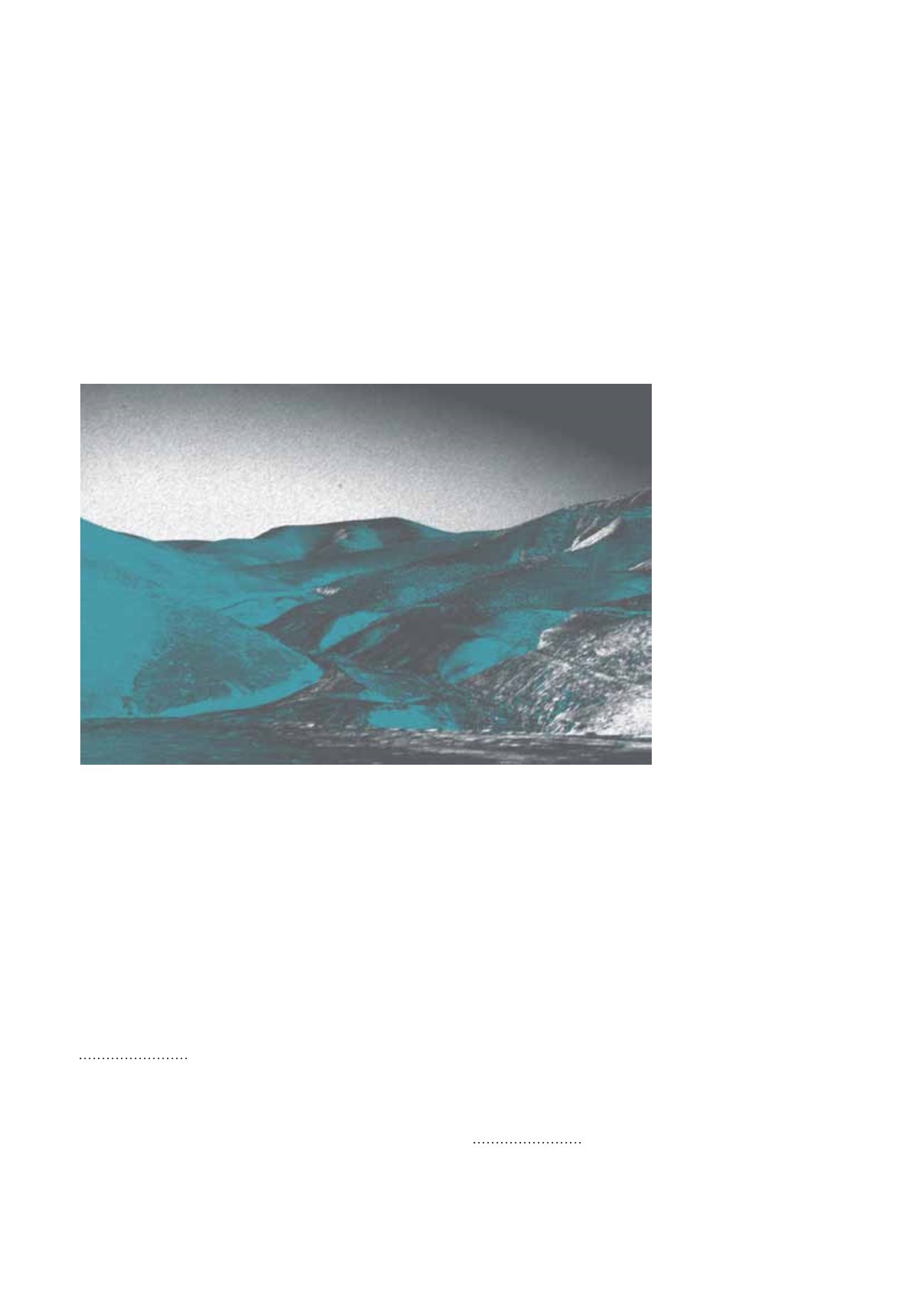
„Und du siehst, dass du alleine bist.“
39
Einsichten und Perspektiven Themenheft 1 | 15
beiseite geschobene Tatsache nahe, dass solche Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit geschehen sind und, da sie
geschehen sind, auch weiterhin möglich sind. Wenn wir
uns der Realität dieser Verbrechen, in denen den Opfern
der Status des Mitmenschen genommen wird, nicht mehr
verschließen können, spüren wir erst, dass dieses Ver-
trauen in den selbstverständlichen Status als Mitmensch
eine basale Grundlage menschlichen Zusammenlebens
darstellt, und dass dieses Vertrauen auf wechselseitige
Anerkennung als Mitmensch eine Illusion ist.
6
Fast alle hier zitierten Berichte über die Verfolgungsge-
schichten beschreiben den plötzlichen und unvorstellba-
ren Schrecken, dass die Mitbürger und Nachbarn in Nazi-
Deutschland binnen kürzester Zeit zu vernichtenden
Verfolgern wurden, und den daraus folgenden, bis heute
währenden Verlust an Vertrauen in die Welt, in Gott, in
die Zukunft. Die alten Menschen verschärfen diese Erfah-
rung eines unkittbaren Bruchs im Weltvertrauen, indem
sie von ihrer schönen Kindheit sprechen, die durch die
NS-Verfolgung ein abruptes Ende fand.
7
6 Jörn Rüsen: Historisch trauern – Skizze einer Zumutung, In: Burkhard
Liebsch/Jörn Rüsen: Trauer und Geschichte, Köln/Weimar/Wien 2001,
S. 63–84.
7 „Ich hatte eine sehr glückliche Kindheit …“ (Lea Jacobstamm) „An mei-
ne Kindheit habe ich schöne Erinnerungen.“ (Inge Stern) „Ich hatte ein
sehr schönes Leben.“ (Leopold Yehuda Maimon) „Seine Kindheit verlief
glücklich und friedlich, bis er sein 11. Lebensjahr erreicht hatte.“ (Jitzchak
Bronstein)
Die Berichte der Überlebenden konfrontieren mit der
Frage: Wie können Menschen ihren Mitmenschen so
etwas antun, wie ist das möglich? „Man kann sich nicht
vorstellen, was wir erlitten haben. Dass Leute anderen
Leuten so etwas antun können!“ (Rena Wiener)
Die Jugendlichen reagieren sehr stark auf die Konfron-
tation mit der Grenzenlosigkeit von Destruktivität: „Ich
war von den Gesprächen dermaßen schockiert, davon,
dass Menschen so mit anderen Menschen umgehen kön-
nen, dass für mich gar nicht die Möglichkeit bestand,
mit jemandem darüber
zu sprechen.“ (Myrjam
Willberg) „Das Erlebte
der Interviewpartner muss
erstmal zu einem durch-
dringen: Man muss erst
einmal einige Tage darüber
nachdenken, bevor man es
wirklich begreifen kann,
dass dieser Mensch mit
dem man gerade spricht,
die unmenschlichen Grau-
samkeiten der Nazis über-
lebt hat!“ (Jonas Röder)
Sensibel und präzise
drücken die Schülerinnen
und Schüler hier aus, wie
die Konfrontation mit den
Schreckenserfahrungen
der Interviewpartner auch
sie selber aus ihren eige-
nen Sicherheiten herauswirft. Sie fühlen, dass vertraute
Sprach- und Verstehensmuster nicht taugen und das
Erfahrene klein reden würden.
8
Offenbar entwickelten sich während der Interviews sehr
starke Gefühle: Als die Menschen im Altenheim von ihren
Schicksalen erzählt haben, haben wir mit ihnen mitge-
fühlt, mitgelitten.“ (Jessica Erli) Die begleitenden Lehrer
führen die „starke emotionale Verbindung“ auch darauf
zurück, dass die Interviewten zum Zeitpunkt ihrer Schre-
ckenserfahrungen im selben Alter wie die interviewenden
Schülerinnen und Schüler waren und sich vielleicht deshalb
besonders stark mit dem Schicksal der damals jungen Juden
und Jüdinnen identifizierten. Aber nicht nur die Jugendli-
chen, alle „spürten die Ungerechtigkeit, Grausamkeit, Will-
8 Eine Schülerin versucht diese Einordnung in vertraute Kategorien, sie
spricht von den „Horrorgeschichten“ und der „mentalen Stärke“, die man
zu ihrer Verarbeitung benötige (Sandra Lörentz).
Foto: Christian Oberlander


















